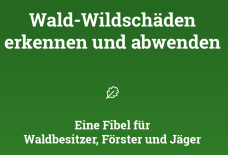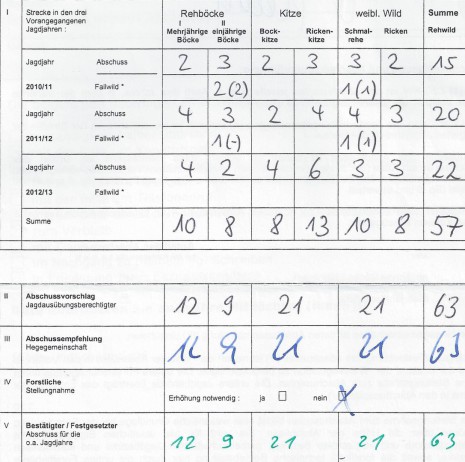Alle Kolumnen seit 1.4.2020
1.8.2022 Kolumne Jagd-Heute
Jäger oder Wildschadenmanager?
Über den Spagat zwischen Jagdfreuden und ernsthafter Wildschadenabwehr
Wir Jäger/innen befinden uns in einer Sinnkrise, könnte man meinen. Die meisten haben einst den Jagdschein gemacht, um Jagderlebnisse zu genießen. Kaum jemand hat sich zur teuren Jungjägerausbildung angemeldet, weil er heiß darauf ist, Wildschäden in Wald und Feld abzuwenden. Doch die Zeiten haben sich geändert. In den letzten Jahren ist offensichtlich geworden, dass die herkömmliche Jagd nicht mehr ausreicht. Noch nie waren die Jäger/innen so gefordert, Wildschäden zu verhindern, die Sauen in den Feldern und Rehe in den Wäldern verursachen. Der Aufwand, der betrieben werden müsste, um wirklich effektive Wildschadenprävention zu betreiben, überfordert derzeit jedoch viele Jäger/innen in den Revieren. Viele von uns - ob Jagdaufseher, „Jagdhelfer“ und vor allem wildschadenpflichtige Jagdpächter – fragen sich mittlerweile: „Sind wir eigentlich noch Jäger oder nur noch Wildschadenmanager?“
In Revieren mit Schwarzwild und Mais (Raps, Weizen, Wiesen…) wird die Situation oft belastend, weil dem Jagdpächter extrem hohe Ersatzkosten blühen. Neulich hörte ich von einem Jagdpächter, der nachts regelmäßig von Albträumen heimgesucht wird. Vornehmlich im September, wenn sich die Lage im Maisrevier zuspitzt. Wiederholt träumte der Pächter, der keine Wildschadendeckelung im Vertrag hat, er stünde weinend in einer großen, von Sauen zerstörten Fläche inmitten der riesigen Maisschläge. Um ihn herum tobt der Bauer wie das wütende Rumpelstilzchen und fordert, fordert, fordert….
Selbst, wenn man als Jagdpächter mit seinem Team alles Menschenmögliche (Arbeit, Zeit, Geld) in die Prävention von Sauenschäden investiert: Wildschäden durch Schwarzwild - auch größere – sind in einem einzelnen Revier nicht komplett zu verhindern. Schäden durch Schwarzwild in der Landwirtschaft sind systemimmanent. Den Sauen wird immer mehr Futter vor die Nase gepflanzt und sie nehmen es gerne an. Andere „Schädlinge“, wie zum Beispiel Läuse im Weizen, werden von Landwirten einfach weggespritzt. Der Pestizideinsatz gegen Wildschweine ist jedoch nicht erlaubt. Also soll es der Jagdpächter richten. Oder zahlen. Dass ein Jagdpächter den Versicherer für subventionierte Landwirte spielen muss, womöglich ohne Unterstützung von Jagdgenossenschaft und Landwirten, ist nicht mehr zeitgemäß. Über diesbezügliche jagdrechtliche Änderungen darf gerne mal nachgedacht werden. Zum Beispiel sollten Landwirte - als mitverantwortliche Verursacher des Problems – grundsätzlich mit in die Pflicht genommen werden. Unterstützung darf allerdings nur derjenige Jagdpächter erwarten, der wirklich ernsthaft an der Reduktion der Schwarzwildbestände mitwirkt. Pächter von Revieren, in denen Sauen mehr gekirrt als gejagt werden, müssen auch weiterhin für Schäden in ihren Revieren geradestehen. (https://www.wildoekologie-heute.de/themen/schwarzwild/zeitgem%C3%A4%C3%9Fe-schwarzwildbejagung/)
Vollkommen anders ist die Situation im Wald. Hier droht dem Jagdpächter nicht wirklich das finanzielle Horrorszenario wie dem Pächter des Sauen-Mais-Revieres. Nicht, weil der Schaden nicht auch sehr groß - meist höher als die Maisschäden - wäre, sondern weil es für Waldbesitzer nicht möglich ist, die Schäden der verschwundenen Eichen und Eschen geltend zu machen. Die Jagdpächter sind derzeit aber gut beraten, die Bejagung der Rehe und Hirsche sehr ernst zu nehmen. Das Gute ist: Wir wissen, wie es geht. Ein Absenken der Verbissschäden funktioniert, wissenschaftlich nachgewiesen, durch entsprechende Eingriffe beim Reh- und Rotwild (u. a. Heute 2022). Die sehr hohen Bestände müssen an den Lebensraum Wald angepasst werden. Jetzt wird sich wieder der eine oder andere Jäger aufregen. Doch das Narrativ vom „letzten Reh“, dass bei intensiver Rehwildbejagung geschossen würde, ist obsolet. Es ist zigfach widerlegt in Revieren „des Forsts“, in denen eine „scharfe“ Rehbejagung nirgends zu nachhaltigen Einbrüchen der Rehpopulationen geführt hätte. Jeder Jäger, der in „seinem“ Revier mal unselektiv viele Rehe geschossen hat, wundert sich, wie viele Rehe im nächsten Jahr immer noch/ wieder da sind. Allerdings: Das Heranhegen eines alten Bockes funktioniert bei einer intensiven Rehbejagung natürlich nicht mehr. Ansprüche und Wirklichkeit müssen daher in vielen Revieren angepasst und neu austariert werden. Das klappt nur, wenn die Jagdpächter ehrlich dazu bereit sind, Schalenwildbestände anzupassen. Und Verpächter auf Einnahmen aus der Jagdpacht und auf Teile des Wildschadenersatzes verzichten. Die Probleme in den Revieren sind derart groß, dass künftig nur sehr klare Pachtmodelle erfolgreich sein werden. Kompromisse werden nicht zum Ziel führen, denn: „In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod“ (Friedrich von Logau - 17. Jahrhundert).
1.6.2022 Kolumne Jagd-Heute
Plädoyer für „alte“ Jagdaufseher
Derzeit werden viele Reviere von neuen Jagdpächtern oder Revierleitern bejagt. Die Tendenz, dass es aufgrund der „Waldkrise“ neue Jagdausübungsberechtigte richten sollen und den langjährigen Jagdpächtern gekündigt wird, dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen, wenn Verpächter (endlich) merken, dass es mit den etablierten Pächtern nicht funktioniert. Auf der Strecke bleiben bei Pächterwechseln – oder der Umstellung von Pacht- auf Regiejagd – oft die bisherigen Jagdaufseher und „-helfer“ des Revieres. Nach dem Motto: Alle man raus, jetzt kommen wir! So verständlich und richtig es in den meisten Fällen auch ist, alte Zöpfe abzuschneiden und einen Neuanfang in der Bejagungsstrategie zu starten: Die „alten Jagdhelfer“ können unter Umständen bei der Umsetzung des neuen Jagdkonzeptes sehr hilfreich sein. Sie haben beste Revierkenntnisse und verfügen oft nicht nur über jagdliches und handwerkliches Geschick, sondern auch über wertvolle Erfahrungen, die die „Neuen“ am Anfang der Jagdpacht überhaupt nicht haben können. Sie besitzen die Kontakte zu den Jagdgenossen und Bewirtschaftern, kennen die Wechsel, Suhlen und „fängische“ Stellen. Diese Erfahrungen der eingesessenen Jäger nicht zu „nutzen“, wäre fahrlässig. Die Tipps dieser Jäger können anfangs dazu führen, dass das eine oder andere Reh oder Schwein mehr auf der Strecke liegt. Und im Moment kommt es aus Waldschutz- und Seuchengründen in vielen Revieren auf jedes Reh und jede Sau an, die erlegt werden können.
Oft steht man sich zunächst aber wechselseitig ablehnend gegenüber. Die „Neuen“ misstrauen den alten Jagdhelfern, weil sie Teil des gescheiterten Systems waren. Man will den kompletten Neuanfang – ohne den (vermeintlichen) Schlaumeier von früher.
Die Jagdhelfer wiederum hatten sich über die Jahre in ihrer Rolle als Revierknecht eingefunden, nicht selten in devoter Dankbarkeit gegenüber den mächtigen „Beständern“. Einen Strategiewechsel zu einer konsequenten Schalenwildbejagung empfinden sie zunächst oft als übertrieben und überflüssig. Zumindest – der Loyalität halber – nach außen. Denn eigentlich waren viele von ihnen schon lange bereit für zeitgemäßere Wege in der Bejagung, wurden aber von den Jagdpächtern jahrelang gegängelt.
Bedingung bei der Übernahme der früheren Helfer ist, dass diese die neue Jagdstrategie voll unterstützen. In vielen Fällen bedeutet dies Abschied nehmen von lieb gewonnenen Traditionen – aber nicht den Untergang des Abendlandes. Im Gegenteil: Ehemalige Jagdhelfer, die vorher als Belohnung ihrer täglichen Arbeit (kirren!) jährlich einen Knopfbock schießen durften, leben in neuen Jagdteams mit flachen Hierarchien auf. Plötzlich selbst tatkräftig an einer möglichst guten Strecke mitwirken zu können und auch den „großen“ Bock schießen zu dürfen, katapultiert die über Jahre ausgebeuteten Hiwis plötzlich auf Augenhöhe mit der Jagdleitung. Sie zahlen es i. d. R. mit großem Engagement, auch bei den Revierarbeiten, zurück. Darauf sollte kein neuer Jagdleiter oder Pächter verzichten!
1.4.2022 Kolumne Jagd-Heute
Zehn Hektar Reviere – Ein Zukunftsmodell?
Die in Brandenburg geplante Novellierung des Landesjagdgesetzes sieht die tiefgreifendsten Veränderungen im Jagdrecht seit 1934 vor. Da wundert es erstmal kaum, dass traditionelle Jäger und Verbände Alarm schlagen ob dieser geplanten Jagdrevolution. Vor allem die Herabsetzung der Mindestgröße von Eigenjagden auf zehn Hektar und die Abschaffung der Abschusspläne treiben die Funktionäre und Jagdpächter zur Weißglut. Doch bedeuten die Pläne der rot-schwarz-grünen brandenburgischen Landesregierung nun den Untergang der „deutschen Jagdkultur“?
Die Empörung darüber, Eigentümer- und Gemeinwohlinteressen über die Interessen der Jagdpächter zu stellen, erinnert an ein jähzorniges Kind, dem man ein gefährliches Spielzeug wegnimmt, das andere verletzten könnte. Das Revier- und Jagdpachtsystem hat - in fruchtbarer Kombination mit einem ausgeprägten Hege- und Trophäenhype - dafür gesorgt, dass in Deutschlands Wäldern zehn- bis zwanzigmal mehr Paarhufer leben als in natürlichen Wäldern. Mit Folgewirkungen, die in der jetzigen Waldkrise existentiell sind. Landauf, landab sind bislang fast alle Versuche gescheitert, Monokuklturen aus Fichten und Kiefern in artenreiche Mischwälder zu überführen. Und das nur wegen des extremen Fressdruckes der Rehe und Hirsche. Es ist Aufgabe der Politik, derartigen Missständen entgegen zu wirken und wirksame Gesetze zu verabschieden. Partikularinteressen, in diesem Fall der Jagdpächter, müssen dabei dem Gemeinwohl untergeordnet werden.
Sollten künftig in Brandenburg Eigenjagdbezirke mit einer Größe von zehn Hektar möglich werden, bedeutet das nicht das Ende des Reviersystems. Im Gegenteil: Es werden mehr Reviere geschaffen, in denen endlich viel mehr Jäger/innen eigenverantwortlich jagen dürfen. Viele von ihnen, die bislang als Jagdaufseher oder Gast in Pachtrevieren den Weisungen des mächtigen Jagdpächters unterworfen waren, dürfen nun davon träumen, bald selbst ein kleines Revier zu bejagen. Im Interesse der Eigentümer, eines klimastabilen Waldes und somit zum Wohle aller!
1.2.2022 Kolumne Jagd-Heute
Gesucht: Jagdpächter fürs Waldrevier
Derzeit stehen wieder Reviere zur Neuverpachtung an. In NRW ist die Nachfrage so groß, dass nicht selten 20 und mehr Interessenten um die künftige Jagderlaubnis buhlen. Paradiesische Zeiten für Verpächter, sollte man meinen. Doch bei Eigenjagdbesitzern und Jagdgenossenschaften hat sich herumgesprochen, dass die Wiederbewaldung nicht funktionieren wird, wenn Rehe und Hirsche nicht ab sofort „anders“ bejagt werden. Doch wie eine „andere“, sprich intensivere Bejagung genau aussehen soll und auch funktioniert, darüber gibt es in den Jagdgenossenschaften meist keine konkreten Vorstellungen. Bei den Jäger/innen übrigens oft auch nicht. Die meisten gehen davon aus, dass sie für die waldorientierte Jagd geeignet sind, weil sie
- den Jagdschein haben und
- bereit sind, mehr Rehe zu schießen als der Vorgänger.
Was alleine nicht ausreicht. Know-how, viel Zeit und Arbeit, (jagd-) handwerkliches Geschick, viele gute Stöberhunde sowie die Bereitschaft, auch andere im „eigenen“ Revier auf Augenhöhe und ohne Jagdneid mitschießen zu lassen, sind wichtige Bausteine der waldorientierten Jagd.
Bei vielen Verpächtern ist mittlerweile durchgesickert, dass man sein Revier nicht mehr unbedingt an den Höchstbietenden verhökern sollte, wenn man eine Gegenleistung beziehen will. Also gehen viele Jagdgenossenschaften und Verpächter her und verpachten ihren Jagdbezirk für – sagen wir mal 20 € anstatt 30 € pro Hektar und Jahr. Als Gegenleistung (um nicht das böse Wort Dienstleistung zu gebrauchen) für diesen Rabatt muss der künftige Pächter – sagen wir 12 Rehe anstatt 8 Rehe pro 100 Hektar – schießen. Ein schöner Kompromiss, denkt man sich auf der Jagdgenossenschaftsversammlung und auch der neue Jagdpächter reibt sich in Vorfreude die Hände. Er braucht nun deutlich weniger zu zahlen als der Vorgänger und soll ein bisschen mehr schießen – warum nicht?
Leider werden Reviere mit solch halbgaren Jagdpachtbedingungen nicht zum erwünschten Wiederbewaldungserfolg gelangen. Schön wäre es, wenn es so einfach ginge! Aber die Rehwildbestände sind in den meisten Waldregionen derart hoch und der Verbissdruck so gewaltig, dass die vier Rehe pro 100 ha, die nun mehr geschossen werden, in der Verjüngung nicht mehr als der Tropfen auf den heißen Stein bewirken. Von Revieren, in denen durch eine intensivierte Jagd artenreiche Naturverjüngungen entstehen konnten, ist bekannt, dass mitunter vier- oder fünfmal mehr Rehe geschossen werden mussten als zuvor. Zumindest für einige Jahre. Viele der Reviere mussten deutlich mehr als 20 Rehe pro 100 ha Wald schießen, um den Verbissdruck auf die Krautschicht des Waldes endlich zu mildern. Übrigens, ohne dass die Rehbestände dadurch erheblich reduziert worden wären.
Verpächtern und Jäger/ innen muss bei Jagdverpachtungen klar sein, dass die erfolgreiche Bejagung eines Waldrevieres einen extrem hohen Aufwand voraussetzt, der mit der herkömmlichen Hegejagd nicht zu vergleichen ist. Und wer ein Revier tatsächlich so bejagt, dass der Wald in seiner ganzen Artenvielfalt ohne jeden Zaun wachsen kann, der hat einen tollen Job gemacht. Der bezahlt werden müsste!
1.12.2021 - Kolumne Jagd-Heute
Die Drückjagd verrät, ob der Jagdpächter es will – und kann
Wieder stehen wir an derselben Stelle wie vor einem Jahr, als pandemiebedingt Bewegungsjagden abgesagt wurden. Mit dem Unterschied, dass in diesem Jahr flächendeckende Lockdowns (noch) nicht vorgesehen sind und im Freien 2G+ Veranstaltungen wie Drückjagden möglich bleiben könnten. Ein glückliches Privileg! Weshalb die Devise für uns Jäger/innen lauten muss: „Wenn schon, denn schon!“ Auch der Glaubwürdigkeit wegen.
Vor genau einem Jahr habe ich in der Kolumne geschrieben: „Die Streckendaten (der Corona- Drückjagden) werden die fahrlässige Untätigkeit der Jagdpachtreviere aufzeigen.“ Was sich vollends bewahrheitet hat und auch in diesem Jahr bestätigt – einen Lerneffekt kann man der Jägerschaft beim besten Willen nicht unterstellen: Vor kurzem war ich auf einer Revier übergreifenden Drückjagd, an der 45 Reviere teilgenommen haben. Ergebnis: 33 Rehe. Das entspricht 0,7 Rehen pro Revier. Das Gebiet liegt in einem unserer Hauptschadensgebiete mit Kahlschlägen soweit das Auge reicht. Das Beispiel zeigt, dass in kaum einem konventionell bejagten Pachtrevier der Ernst der Lage erkannt, geschweige denn gehandelt wird. Aller Absichtserklärungen und offizieller Vorsätze der Verbände zum Trotz passiert in den Revieren: nichts. Oder sehen Sie auf jeder Kalamitätsfläche neu errichtete, geeignete Hochsitze stehen? Ich sehe auf meinen Fahrten durch die Schadensgebiete da bislang fast gar nichts. Das jagdliche Tagesgeschäft in den Pachtrevieren verharrt in stoischer Passivität. Nach dem Motto: „Der Wald stirbt, was juckt’s mich“. Hauptsache es sind viele Tiere im Revier! Apropos: In den Revieren der o. g. Drückjagd tummeln sich nicht nur sehr viele Rehe, die eine diverse Waldverjüngung verhindern. Nachdem von Jagpächtern seit 15 Jahren sehr „erfolgreich“ Muffel ausgesetzt wurden, hat man dort nun auch Damwild zum jagdlichen Vergnügen freigesetzt. Die Behörden schauen tatenlos zu. Oder stützen die illegalen Ansiedlungen sogar!
Solange Jagdpachtreviere machen „was sie wollen“ und die Jagdbehörde die Machenschaften der Pächter auch noch decken, gibt es keine begründete Hoffnung auf eine flächendeckende Lösung des Waldverjüngungsproblems. Und so bleibt die Entscheidung bei dem einzelnen Revier, ob hier künftig wieder Wald entstehen oder ob das Revier weiter zur Befriedigung privater Jagdgelüste verscherbelt werden soll. Viele Wald- Eigenjagdbesitzer haben die unausweichliche Notwendigkeit mittlerweile erkannt: Nur eine sehr intensive Schalenwildbejagung kann überhaupt zu einer artenreichen Wiederbewaldung führen. Wobei das Ausmaß der nötigen Intensität allerdings kaum jemandem bewusst ist. Waldorientierte Jagd ist harte, zeitintensive Arbeit und hat mit der konventionellen Pachtjagd nichts gemein.
Spätestens jetzt - es ist eine Minute vor Zwölf - müssen auch Jagdgenossenschaften reagieren und ihre Reviere von jagd-handwerklich versierten Jagdteams waldorientiert bejagen lassen. In jedem Ort gibt es gute Jäger/innen, die wirklich intensiver jagen würden – sofern der Pachtpreis niedrig ist. In den Revieren würden künftig dann sicher mehr als 0,7 Rehe auf der Drückjagdstrecke liegen.
Ohne professionell organisierte Bewegungsjagd mit ausreichend vielen/ guten Schützen, Durchgehern und Hunden wird es keine artenreiche Wiederbewaldung geben.
1.10.2021 - Kolumne Jagd-Heute
Ökovieh und Hirschherden
Ich habe einen Bekannten, der ist „Bio“- Bauer. Er achtet auf einen geschlossenen Kreislauf im Betrieb und darauf, dass er nur so viele Tiere hält, wie sein Land ernähren kann. Seine Weiden machen pro Hektar Fläche gut zwei Rinder satt – zu Nahrungsengpässen kommt es nicht. Nun ist es aus ökonomischer Sicht immer verlockend, „mehr“ zu machen (Wachstum!). Für meinen Bekannten würden mehr Tiere mehr Geld einbringen. Aber er käme nicht einmal im Traum auf die Idee, auf seinen zehn Hektar Wiesen anstatt seinen 20 Rindern 30 oder gar 40 grasen zu lassen. Weil das Gras nicht ausreichen würde. Seine Tiere müssten hungern. Und keine Maßnahme dieser Welt könnte die Nahrungsknappheit kompensieren (Besucherlenkung? Ruhezonen? Ablenkfütterungen? Gar ein Lebensraumgutachten?). Mehr Kühe würden das Ökosystem Weide durch Fraß und Tritt zerstören. Die Tiere würden sich ihrer eigenen Lebensgrundlage berauben. Schon ein Rind mehr pro Hektar würde das Gleichgewicht des geschlossenen Kreislaufs ins Wanken bringen.
Für unsere Rehe und Hirsche haben die Wildbiologen einst „tragbare“ Wilddichten ermittelt, die noch heute in der Jungjägerausbildung gelehrt werden. Für Rehe galten, je nach Standort, 3 bis 12 Rehe pro 100 Hektar Wald als verträglich. Hirsche sollten es nicht mehr als 1 bis 3 sein. Niemand hat diese Zahlen, die sich die Jagd selbst als „Obergrenze“ auferlegt hat, angezweifelt. Doch nachdem man gemerkt hatte, dass man (Jäger in der Praxis) Rehe und Hirsche nicht zählen kann, machten die nackten Zahlen nur noch wenig Sinn für die Jagdpraxis. Heute sind diese „Obergrenzen“ Schnee von gestern. Und es ist auch wahrscheinlich, dass die Rehdichte aufgrund von Eutrophierung und Klimawandel heutzutage etwas höher sein kann, ohne gleich Schäden zu verursachen.
Doch in unseren Revieren tummeln sich mittlerweile regelmäßig nicht 20, sondern 30 bis 40, oft auch 50 bis 60 und manchmal sogar 70 bis 100 Rehe auf 100 Hektar Wald! In vielen Rotwildgebieten streifen mittlerweile 20 bis 30 Hirsche durch 100 Hektar. Bei einem Gemeinschaftsansitz in einem Rotwild- Hotspot im Siegerland konnten wir im Mai gleichzeitig Rudel beobachten, die auf eine Dichte von 40 bis 50 Hirschen hinweisen. Dichten, die nicht doppelt so hoch sind wie verträglich wäre (was ja schon viel wäre), sondern teils zehn- bis zwanzigmal höher sind als für Wald und Wild verträglich sind. Übrigens gibt es bis heute kein einziges Beispiel dafür, dass bei überhöhten Schalenwildbeständen Hegemaßnahmen wie Ruhezonen, Wildäsungsflächen im Wald oder Besucherlenkung zu einer wirklich artenreichen Waldverjüngung geführt hätten. Genauso wenig (also nullkommanull) werden Lebensraumgutachten dazu beitragen, diverse, klimastabile Wälder aufzubauen, solange die Schalenwilddichten derart hoch sind.
In der Jungjägerausbildung haben wir gelernt, dass wir das Wild regulieren sollen. Doch wer heute wirklich ernsthaft mit der Regulierung beginnt, wird immer noch häufig als „Schädlingsbekämpfer“ diffamiert - von denjenigen, die den Schuss noch immer nicht gehört haben.
7.8.2021 Kolumne Jagd-Heute
Ökologie – Schimpfwort oder Wissenschaft?
Es gibt wohl kaum einen Begriff, der in der Politik so schamlos missbraucht und missverstanden oder gar von skrupellosen Lobbyisten gekapert wurde wie die Ökologie. Diese ist die Wissenschaft von den Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt. Und die Jagd damit mittendrin. Doch in der schwarz-weißen Gut-Böse-Welt der klassischen Hegejagd war alles „Ökologische“ per se böse. Wer oder was „ökologisch“ war, wurde in den traditionellen Reihen der Hegeringe als „natürlicher Feind“ abgestempelt und nicht selten diffamiert. Das gut gepflegte, undifferenzierte Feindbild der Jäger ließ sich in einer Stammtischstimmung aus gefährlichem Halbwissen und Marschrichtung des Jagdverbandes leicht aufrechterhalten. Denn jahrzehntelang ist den Jägern eingetrichtert worden, der größte Feind der deutschen Jagd seien die „Ökos“.
Doch das gesellschaftliche Klima hat sich gewandelt, Umwelt- und Klimaschutz sind mehrheitsfähig geworden. Ökologische Zusammenhänge zu begreifen ist notwendiger denn je. Denn wir befinden uns in einer existentiellen Naturkrise, die auch für den letzten Ignoranten sichtbar geworden ist. Dabei sind Hochwasser und Fichtensterben, so steht es zu befürchten, erst der Anfang der Krise. In der uns eine junge, kritische Generation rund um Fridays for Future weiterhin regelmäßig den Spiegel vorhalten wird. Gerade wir Jäger/innen sollten unser Naturverständnis und unsere Haltung gegenüber Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft daher grundlegend überdenken. Ist Jagd Naturschutz, weil im Revier ein (Enten-) Teich angelegt wurde? Oder kann die Jagd viel mehr, in dem sie das Schalenwild reguliert und die Wiederbewaldung tatsächlich ermöglicht?
Noch immer eifern selbst jüngere Jäger/innen unbeirrt den alten Idealen – Trophäen und Rekordstrecken – nach, wie sie es in Blogs und Jagd-Kanälen im Netz eindrucksvoll hinterlegen. Doch das Spektrum der Jäger/innen ist in den letzten Jahren viel breiter geworden - die Jägerschaft hat sich verändert. Zwar war der Prozess der Öffnung zeitversetzt und schleichend, da man aus einer in sich geschlossenen Welt aus vermeintlichen Traditionen mit einer eigenen Sprache stammt. Doch große Teile der weiblicher und städtischer gewordenen Jägerschaft haben sich emanzipiert. Diese Generation ist grundsätzlich aufgeschlossener und empfindet auch „Öko“ nicht mehr als Schimpfwort, sondern als vernünftige, weil umwelt- und klimaschonende Haltung. „Ökologisch“ ist also nicht der Verein ÖJV, sondern die Attitüde der Jäger/innen in ihrem Mensch-Natur-Verständnis. Bezogen auf die Jagd bedeutet das, sich eben nicht als Herrscher und Bestimmer über eine Handvoll jagdbarer Tierarten zu verstehen, wie der anthropozentrische Jagdpächter, der die Jagd als reinen Selbstzweck ausübt und die Natur dabei als Jagdkulisse gebraucht.
Bei modernen Jäger/innen ist das Mensch-Natur-Verständnis bereits etwas ganzheitlicher geworden. Es ist von dem Wissen geprägt, dass die Klimafrage existentiell ist. Dass Umwelt und Natur dringend geschützt werden müssen. Denn nicht der Hirsch oder das Reh sind bedroht. Es sind unsere Lebensgrundlagen, die bedroht sind.
Die Jagd in Deutschland kann einen kleinen Beitrag im Kampf um die Zukunft leisten. Sofern sie „ökologischer“ wird. Denn um „vor die Krise zu kommen“ (Ausdruck von Norbert Röttgen im Zusammenhang mit Corona), bedarf es in den meisten Revieren eines Paradigmenwechsels. Beim Blick auf die Uhr besser heute als morgen. Und auch im Hinblick auf die Zukunft der Jagd als solche sind wir Jäger/innen gut beraten, den Einklang mit der ethischen Grundhaltung der Gesellschaft zu suchen.
Der Klimawandel rückt uns auf die Pelle. Förster und Ökologen ringen um den richtigen Umgang mit dem Wald von morgen. Und die Jagd? Wäre gut beraten, ihre Grundfeste aus ökologischer Sicht zu überdenken. Endlich den Lebensraum in den Mittelpunkt stellen und wissenschaftsbasiert handeln.
Bild: Ehemaliger Fichtenforst im Bergischen Land.
1.6.2021 - Kolumne Jagd-Heute
Einseitig gut!
In einem Online-Seminar vor Naturschützern hörte ich letzte Woche einen eingesessenen Wildbiologen reden. Es ging - wieder einmal - um die Wald-Wild-Problematik. Alle Vertreter des Waldbaus und der Ökologie waren sich einig, dass eine akute Anpassung der Reh- und Hirschbestände an den Lebensraum erfolgen muss. Es wurden zahlreiche Beispielreviere aus der Praxis aufgeführt, in denen eine Intensivierung der Rehjagd zu erfreulichen Ergebnissen geführt hat: Eine artenreiche (!) Wiederbewaldung, gesunde Rehe und wenig Verkehrsverluste. Einzig der Wildbiologe haderte: Die bloße Forderung nach einer Anpassung der Wildbestände an den Lebensraum – sprich: Reduzierung – sei „zu einseitig“. Dieses (Totschlag-) Argument ist häufig zu hören von Wild- und Jagd- „Experten“, die eher in der Theorie als in der Jagdpraxis zu Hause sind. Die Problematik sei zu komplex, als dass es durch die bloße Erhöhung der Abschüsse funktionieren könne. Selbstredend hatte der Wildbiologe auch die Lösung des Wald-Wild-Problems im Gepäck (die Wildbiologen begründen und erklären den "Hobbyjägern" seit jeher ihr Handwerk). Und wie immer im Werkzeugkasten: Runde Tische, Berücksichtigung aller Interessen, Konzepte, Wildruhezonen, Wildäsungsflächen, Touristenlenkung und Kommunikation! Ganz wichtig! Man müsse der entfremdeten (Stadt-) Bevölkerung den Wald wieder näherbringen. Zum Beispiel – jetzt kommt’s – indem man das Rotwild wieder tagsüber erlebbar macht für die Bevölkerung! Hirsche als umweltpädagogische Leitart für die Rettung des deutschen Waldes! So etwas kann man sich fast nicht besser ausdenken!
Denn in der Tat hat der Wald ein erhebliches Problem mit dem Rotwild. Warum? Weil es gar keine Waldart ist. Hirsche kommen natürlicherweise im Wald gar nicht vor. So wenig wie Steppenantilopen oder Eisbären. Natürliche Offenland-Lebensräume für Rotwild gibt es in Deutschland kaum noch – als geeignete Ersatzlebensräume fungieren allenfalls (ehemalige) Truppenübungsplätze. Die intensiv genutzte Agrarlandschaft fällt als Lebensraum für die großen Rudeltiere per se aus. In unseren Wäldern werden Hirsche gehegt, weil der „König des Waldes“ die größte Sehnsucht der Trophäenjäger ist. Und diese Tierart, die im Wald - in den es gar nicht „gehört“ - teils extreme Wildschäden verursacht, benutzt nun die Wildbiologie, um den Menschen den Wald zu erklären. Verrückt? Wohl eher Kalkül. Denn durch die Pflege des Bambi-Syndroms werden weder das Verständnis für die Ökologie des Waldes, noch die Einsicht der Bevölkerung für die dringend erforderlichen Reduktionsabschüsse größer. Wollte man den Menschen das Ökosystem Wald wirklich ernsthaft erklären, stellte man typische Charakterarten in den Mittelpunkt. Zum Beispiel Hirschkäfer, Mittelspecht oder Eichenzipfelfalter für intakte Eichenwälder. Ob der Wildbiologe diese bedrohten Arten kennt? Vielleicht. Aber es war ihm - einmal mehr - wichtiger, den Rothirsch zu betonen. Wie einseitig.
Der Blaue Eichenzipfelfalter (Neozephyrus quercus) ist - im Gegensatz zum Rotwild - eine der typischen Arten intakter, alter Eichenwälder. Der eher seltene Schmetterling ist eine von 25.000 Insektenarten NRWs, die als Bestäuber wichtige Funktionen im Ökosystem Wald erfüllen. Heute gibt es nur noch ein Viertel der Insekten (in Bezug auf die Biomasse), die es vor 30 Jahren gab. Doch die Wildbiologie feiert weiterhin „ihre“ Leitart Hirsch…!
1.4.2021 - Kolumne Jagd-Heute
Lobby von Rebhuhn und Reh
Ein Teil der Jägerschaft, besonders der um Bewahrung junger Traditionen bangende konservative Flügel, protestiert vehement gegen das geplante BJagdG. Unterstützt wurden die Protestler – selbstredend – vom Jagdboulevard und einer Handvoll alter weißer Männer (und noch weniger instrumentalisierter Frauen), die akademische Titel tragen und den Jagdverbänden seit Jahren brav zur Seite springen, wann immer sie sollen.
Was nun passiert ist, hat sich seit Jahren abgezeichnet: Die wütenden Jäger haben sich unbemerkt mit dem radikalen Tierschutz verbündet! Schon seit Jahren ziehen Rotwild-Fans mit Revieren in den Kerngebieten gegen mutmaßlich nicht weidgerecht jagende Reviernachbarn - gerne aus dem Forst - vor Gericht, um diese wegen Tierschutzvergehen verurteilen zu lassen. Zwar erfolglos, wie in fast allen Fällen in NRW, aber die Denunziationen erzielen dennoch Wirkung. Denn mit jeder Anzeige wird der Eindruck erhärtet, dass „der Forst“ die Bösen sind, weil ihm Tierschutz ja schnuppe ist. In die Hochphase des „Rotwild-Krieges“ (vom Jagdverband ausgerufen, vor Gericht gebracht und dort verloren...; RWJ 09/2015) fällt auch das letzte Aufflackern des Leitbachen-Paradigmas. Kein Zufall. Den mit der permanenten Überbetonung des Selbstverständlichen – des Muttertierschutzes – erreichten die besorgt wütenden Hegebeauftragten, dass „der“ Tierschutz immer aufmerksamer auf das Thema gemacht wurde. Vielleicht wurde deshalb allmählich wieder von der Strategie „Totaler Muttertierschutz“ abgelassen. Diese hatte offensichtlich zum Ziel, Alttiere und Bachen möglichst komplett vor Abschüssen zu verschonen, um so die sprudelnden Quellen der Reproduktion zu sichern. Jetzt also ist dieser Irrsinn den Strategen von damals auf die Füße gefallen. „Der“ Tierschutz ruft in einer Petition gegen das BJagdG und einen „Wald ohne Jäger“ auf – und zehntausend Jäger unterschreiben! (DJZ-online am 11.3.2012).
Der Keil, den Jagdverbände und Boulevardpresse in die Jägerschaft getrieben haben, sitzt offenbar so tief, dass an dessen Ende die (ehemaligen) Jäger lieber zum Tierschutz wechseln, als auf der Drückjagd auf Rehe zu schießen, von denen es in Deutschland mehr gibt als jemals zuvor! Oder haben die Unterzeichner die Petition gar reflexhaft und ganz und gar unreflektiert unterzeichnet? Ganz nach dem Motto: Hauptsache kein waldfreundliches Gesetz? So oder so, es ist ein Armutszeugnis für den Zustand der Jägerschaft, wenn sie sich über Jahre so sehr von alten weißen Männern fehlleiten lässt, dass sie am Ende eine Petition des radikalen Tierschutzes unterstützt.
Themenwechsel: Nach Jahren war ich im März mal wieder zu einer Brutvogelkartierung in der münsterländischen Agrarlandschaft. Bis 2015 hatte ich in einem zehnjährigen Forschungsprojekt den Niedergang der Rebhühner in den einst besten Revieren des Münsterlandes dokumentieren müssen. Glücklicherweise konnten sich in diesen Feldfluren mit extensiver Landwirtschaft und Brachflächen Restbesätze der Rebhühner halten. Noch. Denn in der herkömmlich bewirtschafteten Ackerlandschaft mit intensivstem Wintergerste-, Triticale- und Maisanbau ist der Artenschwund unentwegt fortgeschritten. Grauammer, Ortolan und Bluthänfling brüten hier längst nicht mehr. In den letzten Jahren sind nun Rebhühner und Kiebitze vielerorts lokal verschwunden – um nicht zu sagen ausgestorben. Und mit ihnen etliche Insektenarten. Und wo man (fast) kein tierisches Leben mehr in der Agrarlandschaft findet, werden Landwirte nun mit der Genehmigung von Windkraftanlagen „belohnt“. Hier kann man ja keine Natur mehr zerstören. Die bäuerliche Kulturlandschaft ist fast vollends zur Energiegewinnungs- und Futterfläche für die Massentierhaltung mutiert. Mit Ansage! Ohne dass Politik und Bauernverbände je wirksame Maßnahmen zum Schutz der Restnatur umgesetzt haben. Derzeit steht die EU-Agrarpolitik vor einer grundlegenden Weichenstellung. Doch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft möchte seine Groß-Agrarier nicht zu viel Naturschutz „zumuten“. Daher wird es auch keinen Systemwechsel in der Landwirtschaft geben, wie von Ministerin Klöckner vollmundig angekündigt. Für die Rebhühner und Kiebitze in den Revieren, in denen ich in den letzten Wochen unterwegs war, kommt so oder so jede Hilfe zu spät.
1.2.2021 - Kolumne Jagd-Heute
Berlin, Berlin - Wir schauen nach Berlin
Jagd und Landwirtschaft sind in den letzten Tagen mediales Thema gewesen. Die digitale Grüne Woche in Berlin ist – wie seit Jahren – Anlass für Treckerfahrer und Kritiker der industriellen Landwirtschaft, auf die Straße zu gehen, bzw. zu fahren. Und im Bundestag wurde der Entwurf des neuen Jagdgesetzes debattiert. Beides – Proteste der Landwirte wie das Agieren der Politiker – offenbaren, dass im jagdlich-bäuerlichen Umfeld dieselben Probleme mit Populismus und Wissenschaftstrotz grassieren wie in unserer Gesamtgesellschaft.
Die nicht enden wollenden Proteste der Landwirte gegen niedrige Lebensmittelpreise in den Geschäften verschleiern den Blick auf die grundlegenden Probleme der deutschen Landwirtschaft. Es wird zu viel Masse produziert – auf Kosten von „kleineren“ Bauern, Qualität und vor allem der Umwelt. In seinem aktuellen „Bodenreport“ belegt das Bundesamt für Naturschutz, dass nicht nur die sichtbare Artenvielfalt der intensiv genutzten Feldflur rapide Schaden nimmt, sondern auch die Artengemeinschaften der Bodenlebewesen in Acker- und Wiesenböden. „Wir müssen (…) den Schutz des Bodenlebens stärker in den Blick nehmen. Denn sollten Arten in unseren Böden aussterben, die uns teilweise noch gar nicht bekannt sind, so sind die Folgen für die Ökosysteme, aber auch für die Landwirtschaft in ihrer Tragweite noch gar nicht abzusehen“, mahnt daher BfN-Präsidentin Beate Jessel. Für die in der Gesellschaft so angezählte Landwirtschaft wäre es wünschenswert, wenn die Intensivlandwirte sich endlich zur Selbstreflexion besännen. Indem Sie zunächst mal vor der eigenen Verbandshaustür kräftig kehren. Eine Läuterung von innen heraus und aus eigenem Antrieb könnte zu einem guten Ergebnis führen. Andauernde Schuldzuweisungen und Meckern über zu hohe Umweltstandards wird die Akzeptanz dieser Landwirtschaft jedenfalls nicht fördern. Ins absolute Abseits schießen sich darüber hinaus Wutbürger-Bauern des „Landvolks“, die mit rechtsradikalen „Pflug und Schwert“-Fahnen einer völkisch-nationalistischen Bewegung an ihren subventionierten Treckern durch die Hauptstadt ballern.
Selbstreinigungskräfte und Vertrauen in die Wissenschaft möchte man auch den traditionellen Jagdverbänden wünschen, die einen Richtungswechsel in der Jagdpolitik befürchten. Eine Phalanx aus konservativen Jagdfunktionären und willfährigen Wildbiologen hat sich in der Kontroverse ums Jagdgesetz in eine Art „konservative Esoterik“ verstrickt. Wissenschaftlichen Ergebnisse werden von den alten, weißen Männern negiert, indem man „eigene Fakten“ schafft, die eher einem Bauchgefühl entspringen als wissenschaftlicher Erkenntnis. Nach dem Motto „es kann nicht sein, was nicht sein darf“ (Bezeichnenderweise nach dem Gedicht von Christian Morgenstern „Die unmögliche Tatsache“). Sascha Lobo, Kolumnist des Spiegels, definiert konservative Esoterik so: „Konservative Esoterik, die das längst nicht mehr Tragbare mithilfe von Täuschungen, Torheiten und Taschenspielertricks bewahren möchte, ist auf dem Vormarsch. (…). Das liegt erstens an der Unerträglichkeit, dass hier Männer einer längst verblichenen Selbstverständlichkeit anhängen, der Bühnenzote, der Herstellung infamer Zusammenhänge, der offenen Faktenleugnung, dem "das existiert nicht, weil es verboten ist". (…) Viele Konservative vertragen nicht gut, dass sich in den letzten zwanzig Jahren eine größere Zahl konservativer Grundannahmen über Welt und Gesellschaft als mittelstark gequirlter Quark herausgestellt haben. (…) Der Atomausstieg, das Versagen des Konzepts schwarze Null, die Wucht der Digitalisierung, die Fliehkräfte der EU, die ungeheure Dringlichkeit des Klimawandels, so geht es immer weiter. Die Welt hat sich einfach substanziell anders entwickelt, als konservative Köpfe glaubten. Wenn man in solchen Situationen trotzdem noch auf den gleichen Weg bleiben möchte wie vor dem Wandel, mit den gleichen Instrumenten, den gleichen Sprüchen, den gleichen Überzeugungen - dann hilft eben nur noch konservative Esoterik“ (Sascha Lobo 2020).
Dass es die konservative Esoterik auch in die Debatte über das Jagdgesetz (am 27.1.) in den Bundestag geschafft hat, verwundert kaum. Einer völlig am Thema und wissenschaftlichen Fakten vorbei schwadronierenden AfD folgte ein Musterbeispiel konservativer Esoterik. Hier wurde von einem FDP-Abgeordneten - unter anderem - ernsthaft behauptet, die Reduktion des Rehwildes allein sei kein geeignetes Mittel, um die Waldregeneration zu garantieren. Offensichtlich schaut die FDP da seit vielen Jahren an der jagdlichen Realität und, noch schlimmer, an eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen vorbei. Solch hanebüchenen Auftritte von AfD und FDP im deutschen Bundestag können einen schon nervös stimmen, wenn man sich ausmalt, was unverantwortliche Lobby-Politiker im deutschen Bundestag mit hetzerischen Reden anrichten könnten, wenn es mal um wichtigere Dinge als das deutsche Weidwerk geht.
Wie beruhigend war es dagegen, die Redner von CDU, CSU, SPD, Grünen und LINKE zu verfolgen. Politiker/innen, die allesamt sachlich und vernünftig über akzeptierte Fakten debattieren, um sich einer sinnvollen politischen Lösung anzunähern. Auch wenn das Jagdgesetz den Erwartungen vieler Ökologen, Naturschützer und „Waldmenschen“ am Ende nicht entsprechen sollte: Die Debatte hat gezeigt, dass die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Jagdreform parteiübergreifenden, ernsthaften Zuspruch findet. Die Deutungshoheit über die Jagd in Deutschland ist auch im Bundestag gekippt. Wir Jäger sollten dankbar sein, dass das Jagdgesetz in einem demokratischen Prozess entwickelt wird, in dem extreme Parteien und Einflüsse konservativer Esoteriker hoffentlich keinen Einfluss finden.
Qualität oder Quantität? "Bauernhof" in Mecklenburg samt ausgelaugter Ackerscholle
1.12.2020 - Kolumne Jagd-Heute
Wochen der Wahrheit
Es sind bewegende Wochen für Jäger. Der Ausbruch der ASP hält uns in Atem, Corona erschwert die Bewegungsjagden und das Bundesjagdgesetz wird erstmals seit 44 Jahren umfassend novelliert. Und über all dem schwebt die Frage, was „die“ Jäger wirklich leisten können – oder überhaupt wollen. Und welche Art von Jagd tatsächlich systemrelevant ist.
Wie wenig fortschrittlich die längst überfällige Novellierung des Bundesjagdgesetzes geraten ist, zeigt ein Blick auf einige Bundesländer, die teils schon vor Jahren deutlich zielstrebigere Landesgesetze auf den Weg gebracht haben (NRW, BW, Thüringen). Der Entwurf wurde bereits in der August-Kolumne kritisiert: „Inhaltlich bleiben … etliche Themen unberührt, die dringend einer Anpassung bedürfen, u.a. die Liste der jagdbaren Tierarten, die Jagdpachtdauer, Mindestgröße von Eigenjagden oder die Synchronisation der Jagdzeiten - um nur sehr wenige zu nennen. Darüber hinaus wäre es im Jahr 2020 an der Zeit, die jagdlichen Paradigmen des vergangenen Jahrhunderts zu bereinigen und Begriffe wie Hege, Hochwild, Jagdschutz, Weidgerechtigkeit oder Wildbewirtschaftung neu zu definieren.“ Dass in den Revieren nun „Abschusskorridore“ anstatt Mindestabschüsse für Rehe verhandelt werden sollen, ist ein albernes Zugeständnis an die Hegejagd, denn man kann mit jagdlichen Mitteln gar nicht „zu viele“ Rehe in einem Revier schießen.
Spannend wird die Entwicklung der Jungjägerausbildung werden, da die Länder nun verbindliche Regeln für die Jagdschulen erarbeiten müssen. 14 Tage Intensivkurse wird es nun nicht mehr geben können. Außerdem müssen in neuen Fachgebieten jetzt diese Themen ausgebildet werden:
- Wildschäden, insbesondere ihre Erkennung und Vermeidung, sowie die Grundsätze der Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern oder Bewirtschafterinnen der betreffenden Flächen sowie
- … Erfordernisse einer Verjüngung des Waldes, insbesondere hinsichtlich ihrer jeweiligen Wechselwirkung mit Wildbeständen und Jagdausübung, sowie des Natur- und des Tierschutzes.
Doch wer soll diese anspruchsvollen Fächer überhaupt lehren? Die Länder werden vorgeben, welche Qualifikation die Ausbilder in den einzelnen Fächern künftig aufweisen müssen. Für NRW ist eine entsprechende Verordnung in spätestens 1,5 Jahren zu erwarten. Sie könnte die Welt der Hochleistungs-Jagdschulen auf den Kopf stellen.
Dass die Politik trotz der hochdynamischen Zeit hinter dem jagdlichen Handlungsbedarf herhinkt, zeigen auch das jüngst veröffentlichte Wiederbewaldungskonzept für NRW und die Richtlinie zur Förderung der Waldbesitzer. Während man sich im Forst alle paar Jahre neu erfindet und ein Konzept nach dem nächsten erfindet, bleibt man beim Thema Jagd beim Alten – ganz zur Befriedigung von Wildbiologie und Hegejagd. Allen Ernstes wird den Jägern für eine erfolgreiche Wiederbewaldung empfohlen, Prossholzflächen anzulegen und im Wald 2-3 % der Holzbodenfläche zu Wildwiesen zu machen (wie seit 40 Jahren…)! Es ist nicht nachzuvollziehen, dass solche obsoleten Hegemaßnahmen im Jahr 2020 noch immer in einem Konzept der Fachbehörden erscheinen. Damit wird bloß von der Hauptaufgabe der Jagd - der Reduktion der Bestände - abgelenkt. Welche Maßnahmen wirklich notwendig sind, wird im Konzept nicht erwähnt.
Dass die Traditionsjäger in den letzten Monaten mit einem dicken blauen Auge davon gekommen sind, belegt auch die neue Förderrichtlinie für NRW. Steuerzahler werden weiter für die Wildhege und Verweigerungshaltung der Jagdpächter bezahlen müssen – in Form von Zuschüssen für Großpflanzen, Plastikhüllen als Verbissschutz oder 3000 qm großen Gattern. Die Jagdpächter können sich getrost auf der Kanzel zurücklehnen – der Staat bezahlt im Voraus. Leider wird hier mal wieder überdeutlich, dass die Jagd im Land NRW noch immer nicht als DIE entscheidende Stellschraube für einen erfolgreichen Wald(auf)bau gesehen wird. Anstatt weiterhin mit der Gießkanne den Flächenbrand löschen zu wollen und Steuergeld für Reh- und Hirschfutter zu verbrennen, hätte die Förderung einer ökologisch orientierten Jagd Anreize schaffen können, so dass mehr Reviere waldorientiert bejagt würden. Die Förderung zertifizierter Reviere, z. B. von Ansitzeinrichtungen und Jagdhunden, wäre gerecht und zielführend!
Ach ja: Ist die Jagd denn nun systemrelevant? Haben wir Jäger das Privileg verdient, das uns das Recht gibt, im Shutdown mit großer Mannschaft zur Drückjagd zu schreiten? Die Antwort habe ich in den letzten Wochen deutlich erhalten: Jein. Der größte Teil der Jagdpachtreviere verzichtet derzeit gänzlich auf die Durchführung von Drückjagden, da sich ohne geselliges Schüsseltreiben der Aufwand „nicht lohnt“ und die Jagd „keinen Spaß“ macht. Oder man bimmelt bei der Drückjagd mit drei Hunden und fünf Schützen durchs Revier. Der Vergleich der Streckendaten der Revier übergreifenden Drückjagden aus den Vorjahren mit diesem Jahr werden die fahrlässige Untätigkeit der Jagdpachtreviere aufzeigen.
Im Gegensatz dazu haben die vielen professionell organisierten Bewegungsjagden (im Forst) mit vorbildlichen Hygienekonzepten und disziplinierten Jäger/innen gezeigt, was man erreichen kann, wenn man es wirklich ernst meint mit der Jagd. Dann ist man auch systemrelevant!
1.10.2020 - Kolumne Jagd-Heute
Schweinepest und Hirsch-Kampagne
Jetzt ist sie also da, die Afrikanische Schweinepest (ASP). Und seither erreichen uns täglich neue Hiobsbotschaften aus dem östlichen Brandenburg. Ob über das behördliche Versagen, die Forderungen der Landwirte oder die rasche Ausbreitung. Ziel ist es, so Bundesministerin Klöckner, Deutschland so schnell wie möglich wieder ASP-frei zu machen. Als Vorbild kann Belgien gelten, das die Seuche wahrscheinlich überstanden hat. Vorderste Motivation dabei ist der Schutz der Landwirte aus der Schweineproduktion. Wie immer in landwirtschaftlichen Krisenzeiten wird seitens der Landwirtschaft viel von der Gesellschaft gefordert – insbesondere Geld. Dass aber nur grundsätzliche strukturelle Änderungen der Agrarpolitik eine weitere Intensivierung und Höfesterben verhindern werden, muss jedoch in diesem Zusammenhang gesagt werden.
Der Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch liegt bei 120 % (statista). Der Schweinefleischkonsum in Deutschland geht seit Jahren zurück, die Produktion nicht. Zur Freude der Agrarindustrie, die weiter „Billigfleisch“ und Schweineschnauzen nach China exportiert, sobald das Embargo wieder aufgehoben sein wird. Möglich machen das Schweinefabriken mit 20.000 Tieren, die bis zur Abfahrt zum Schlachthof zusammengepfercht auf verkoteten Betonspaltenböden stehen. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Schweinebetriebe um 35% gesunken, die Produktion aber fast auf gleichem Niveau geblieben. Die Betriebe werden immer größer. Mittlerweile gibt es über 500 Betriebe mit mehr als 5000 Schweinen (Bauernzeitung). Diese Art der Landwirtschaftsindustrie verursacht furchtbare Umweltschäden vor unserer Haustür, in dem sie unsere Böden und das Grundwasser belastet und die Biodiversität der Feldflur dezimiert. Deutschland ist – mit den USA – der größte Schweinefleischexporteur der Welt. Muss das sein? Für den Profit einiger weniger Agrarindustrieller? Damit eine Handvoll „Großbauern“ - mitunter Investoren aus dem Ausland - ordentlich verdienen (siehe Maurin in taz), werden kleinere Bauern in den Ruin getrieben, unsere Ressourcen gefährdet und Insekten- und Vogelarten ausgerottet.
Themenwechsel: Diese Woche wurden mal wieder Forderungen von der Deutschen Wildtierstiftung nach mehr Lebensraum für den Rothirsch laut (Rothirschkampagne). Die Idee, dass Hirsche sich neue Areale erobern und mehr Land besiedeln ist zwar romantisch und dürfte vielen Jagdpächtern glänzende Augen bereiten, doch ist sie enorm verklärt. Und wie so oft verzichten diejenigen, die für (noch) mehr Wild plädieren darauf, auch jene Argumente zu nennen, die gegen eine weitere Ausbreitung der Hirsche sprechen.
Die Tierart Rotwild ist in keiner Weise bedroht, im Gegenteil. In den letzten 20 Jahren haben sich Hirsche in Deutschland rasant vermehrt, weil sie – wie andere Schalenwildarten – vom günstigen Klima, der besseren Nahrungsgrundlage und der extensiven Jagd inklusive Fütterung in den ach so kalten Wintern profitieren. Es ist wahrscheinlich, dass es in Deutschland nie mehr Hirsche gab als derzeit. Und dass, obwohl kaum natürlicher Lebensraum des Hirsches in unserer Kulturlandschaft vorhanden ist. Das Rotwild lebte ursprünglich („früher“ bei uns) in offenen und halboffenen Landschaften wie den Auen oder oberhalb der Baumgrenze im Gebirge. Die in Rudeln lebenden Tiere betreiben vorwiegend eine visuelle Feindvermeidung, da die großen Tiere in der offenen Landschaft den Wolf bereits von weitem sehen und rasch reagieren konnten. Solche Landschaften finden wir in Deutschland außerhalb der landwirtschaftlich genutzten Standorte fast nur noch auf wenigen Truppenübungsplätzen. In NRW z.B. dürften überhaupt nur zwei (kleine) Gebiete groß genug sein, um jeweils einer kleinen Rotwildpopulation zu genügen (Senne und Dreiborner Hochfläche/ Eifel). Immerhin kommt Rotwild in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft auf 25% der Fläche vor. Allerdings nicht in seinen typischen Biotopen, sondern fast ausschließlich im Wald. Einem Biotop, das ihnen nicht „liegt“, weil sie hier keine Freiflächen zum Grasen finden und den Wolf nicht kommen sehen.
Kommen Hirsche in Dichten von ein bis drei Tieren pro 100 ha vor, nischen diese sich problemlos auch in das Ökosystem Wald ein. Zumindest sofern parallel nicht auch Muffel-, Dam- oder Sikawild vorkommen und die Rehdichte ebenfalls „passt“. In den meisten Rotwildregionen NRW’s liegt die Dichte aber um zehn Stück pro 100 ha – in manchen Gebieten auch bei 20 oder gar 30 Tieren! Also zehnmal mehr als der Wald „verträgt“. Eine jagdliche Regulation der Hirsche ist in vielen Verbreitungsgebieten offenbar seitens der Hegegemeinschaften nicht gewollt oder man ist handwerklich nicht dazu in der Lage.
Die vielen Hirsche drängen innerhalb ihrer „Bezirke“ nun, um Arealerweiterung bemüht, nach außen. Dort finden sie eine intensiv genutzte Feldflur vor, in der zwar Nahrung vorhanden ist, aber der Druck durch Erholungssuchende und Verkehr viel zu hoch ist. Abgesehen davon verursachen große Hirschrudel auch erhebliche Wildschäden in der Landwirtschaft. Kein Wunder also, dass viele Landwirte einer Ausbreitung der Hirsche skeptisch gegenüber stehen. Ganz abgesehen von den Waldeigentümern. Wer einmal einen (ehemaligen) „Wald“ in einer der Hotspot-Regionen der Hirschwildschäden gesehen hat, wird sich keine Hirsche in seinem Wald wünschen. In manch einem Hirschrevier der Kerngebiete hat das Rotwild Wälder in Baumsteppen verwandelt (vgl. Heute 2016).
Grundsätzlich ist nichts daran auszusetzen, wenn Wildtiere neue Areale besiedeln. Doch aktuell darf sich das Rotwild nicht verbreiten, weil die verantwortlichen Jäger in Hegegemeischaften und die Jagdpächter es nicht schaffen, das Rotwild auf Dichten von ein bis drei pro 100 ha zu regulieren. Offensichtlich gilt in den meisten Regionen weiter das jagdliche Motto: Möglichst viel Wild und viele Trophäenträger. Solange die seit vielen Jahren grassierenden Probleme in etlichen Rotwildbezirken nicht gelöst sind, ist der Ruf nach mehr Lebensraum für das Rotwild nur Effekthascherei, die auf die „Bambi-Mentalität“ eben jener Stadtbevölkerung setzt, die sonst gerne als naturentfremdete Jagdgegner stigmatisiert werden.
Das Bundesjagdgesetz hinkt, wie etliche Hegegemeinschaften und Hegeringe, den Erfordernissen einer zeitgemäßen Jagd weit hinterher. Seit fast vierzehn Jahren wird diese Kyrillfläche im Siegerland von Rehen und Hirschen entmischt, ohne dass Jagdausübungsberechtigte oder Hegegemeinschaft reagieren.
Kolumne vom 1.8.20
Der Entwurf des Bundesjagdgesetzes – Weder Fisch noch Fleisch
Mit großer Spannung war der Entwurf zur Änderung des Bundesjagdgesetzes vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erwartet worden. Bei manchen mit eher bangem Blick in Anbetracht der Reichweite, die das neue Gesetz auf die traditionelle Hegejagd haben könnte. Bei anderen hatte sich zuletzt Hoffnung breit gemacht, dass das BJagdG auch grundlegend an den anhaltenden Schalenwildboom angepasst würde – hatte Ministerin Julia Klöckner (CDU) die Bedeutung der Jagd für den Wald zuletzt doch wiederholt betont. Der jetzt vorliegende Entwurf ist allerdings nur ein Schrittchen in Richtung zeitgemäßer Jagd. Es wurde an wenigen Stellen, eher im kosmetischen Bereich, korrigiert. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
- Jagd, bzw. die „Hege“ soll „eine Naturverjüngung des Waldes im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen ermöglichen.“
- Jagdausbildung: Künftig müssen Jagdschüler mindestens 130 Stunden Ausbildung durchlaufen. Die Inhalte der Jagdausbildung werden neu definiert und die Themen Wildschäden („Grundsätze der Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern“) und Waldbau („Erfordernisse naturnaher Waldbewirtschaftung und Naturverjüngung“) stärker gewichtet.
- Büchsenmunition: Es kommt kein Bleiverbot, sondern ein Minimierungsgebot.
- Nachtzielgeräte werden für die Jagd auf Schwarzwild erlaubt.
- Tellereisen und Fangeinrichtungen, in denen Greife gefangen werden könnten, werden verboten.
- An Grünbrücken darf im Umkreis von 250 Metern nicht gejagt werden außer an wenigen Stunden bei Bewegungsjagden.
- Abschusspläne: Behördliche Abschusspläne für Rehwild entfallen. Jäger und Verpächter bzw. Eigentümer müssen aber Mindestabschusspläne vereinbaren (längstens für drei Jahre). Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, schreibt die Behörde den Mindestabschuss vor, ggf. unter Berücksichtigung des forstlichen Verbissgutachtens.
Alle genannten Änderungen des Jagdgesetzes sind nachvollziehbar. Mit Ausnahme des aufwändigst geänderten §18, in dem Büchsenmunition mit Bleianteilen legal bleiben, obwohl in der Praxis seit Jahren hervorragende bleifreie Geschosse verwendet werden. Dass Tellereisen und Fangenrichtungen für Greife erst im Jahr 2020 verboten werden, zeigt, wie veraltet das Gesetz in weiten Teilen (immer noch) ist.
Die vehemente Forderung von Waldbesitzern, Ökologen und Förstern, das Gesetz „waldfreundlicher“ zu gestalten, wurde nur ansatzweise berücksichtigt. Zwar ist nun endlich festgelegt worden, dass in den Revieren grundsätzlich das Aufkommen von Naturverjüngung ohne Zaun funktionieren muss. Doch wirklich praktisch wird das Gesetz nur in dem Punkt der Abschusspläne für Rehe. Eigenjagdbesitzern und Verpächtern ist es nun möglich, ihre eigenen Vorstellungen vom Rehwildabschuss in ihren Revieren vorzugeben.
Mit den „Hochwild“- Arten befasst sich der Entwurf erst gar nicht. Als wären nicht gerade die meisten Rot-, Sika- und Damwildregionen waldbauliche Krisengebiete, in denen kein naturnaher Waldbau ohne Zaun möglich ist.
Positiv ist die Erweiterung der Jungjägerausbildung um die Lehrinhalte „Zusammenarbeit mit den Bewirtschaftern“, „naturnaher Waldbau und Naturverjüngung“ zu bewerten. Denn es ist erschreckend, über wie wenig Artenkenntnisse viele Jungjäger verfügen. Und Wildschäden im Wald, wie selektiver Verbiss und Entmischung, werden bis heute von kaum einem (Jung-)Jäger erkannt.
Die Erlaubnis, Nachtzieltechnik auf Schwarzwild zu verwenden ist überfällig, wird aber die Wildschweinbestände nicht reduzieren. Hierzu fehlt der Wille in vielen Revieren, in denen Wildschäden keine Rolle spielen oder von solventen Jagdpächtern – quasi als Wildfutter – aus der Portokasse bezahlt werden.
Obwohl die Jagd vor den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten steht, wurde die Gelegenheit einer Reform verspielt, obwohl der hauseigene „Wissenschaftliche Beirat Waldpolitik“ dem Ministerium eine „grundlegende Neuausrichtung“ der Jagd angeraten hatte. Doch von einer Neuausrichtung kann keine Rede sein. Zum Beispiel wird der Begriff „Hege“ lediglich um die o.g. Naturverjüngung erweitert. Doch Jungjägern wird in der Ausbildung, wie seit Jahrzehnten, weiterhin die „Wildhege“ eingeimpft. Hier lernt der Jungjäger, wie man die Bestände "artgerecht“ bejagt, u.a., um entsprechende Trophäen zu generieren. Wie Reh- oder Hirschbestände wirksam reduziert werden, lernt der Jungjäger i.d.R. nicht.
Inhaltlich bleiben im Entwurf etliche Themen unberührt, die dringend einer Anpassung bedürfen, u.a. die Liste der jagdbaren Tierarten, die Jagdpachtdauer, Mindestgröße von Eigenjagden oder die Synchronisation der Jagdzeiten - um nur sehr wenige zu nennen. Darüber hinaus wäre es im Jahr 2020 an der Zeit, die jagdlichen Paradigmen des vergangenen Jahrhunderts zu bereinigen und Begriffe wie Hege, Hochwild, Jagdschutz, Weidgerechtigkeit oder Wildbewirtschaftung neu zu definieren. Stattdessen wird die Jagd immer noch damit begründet, dass „Störungen des biologischen Gleichgewichts“ ausgeglichen werden sollen und verharrt somit in der wissenschaftlichen Steinzeit.
Die äußerst zaghafte Novellierung macht klar, dass nachfolgende Regierungen in absehbarer Zeit das Gesetz erneut ändern müssen. Dann vielleicht endlich mit mutigen Entscheidungsträgern, die das Bundesjagdgesetz fit für die Zukunft machen. Bis dahin bleibt es den Reviereigentümern überlassen, ihre Reviere von aufgeschlossenen Jägern zielorientiert bejagen zu lassen, wie es heute schon mancherorts praktiziert wird. Zum Glück steht eine junge, engagierte Jägergeneration in den Startlöchern, die abseits überholter Traditionen bereit ist, die enormen Herausforderungen der Jagd anzugehen. Bislang hinkt das Bundesjagdgesetz mit seinem „Reförmchen“ noch weit hinterher.
Kolumne vom 1.6.20
Deutungshoheit über Jagd kippt
Die Jagd wandelt sich rasanter als je zuvor. In den letzten Jahren sehen sich Jäger/innen dramatisch eingebrochener Niederwildbesätze und gleichzeitig immer weiter ansteigender Schalenwildbestände gegenüber. Zeitgleich wurde die „Jagdtechnik“, wie Nachtsicht und Meldesysteme, extrem verbessert und die junge Jägergeneration zeichnet, auch via Influencern, ein ganz frisches Bild der Jagd. Und emanzipiert sich von „Jagdherren“ und der boulevardesken Jagdpresse. Außerdem wächst das gesellschaftliche Bewusstsein für Tierschutzbelange weiter. Dadurch „verschieben sich althergebrachte Positionen zur Frage, wie Jagd durchzuführen sei“ (WBW 2020). Bewahrer der Jagd, „wie wir sie von unseren Altvorderen gelernt haben“ und Reformer liefern sich derzeit eine heftige Auseinandersetzung um die Deutungshoheit über die Jagd in Deutschland.
Jagd, also das Aufsuchen, Nachstellen und Töten von Wildtieren, wird weltweit und völlig unterschiedlich betrieben. In Afrika werden Antilopen so lange durch die Wüste gehetzt, bis sie entkräftet getötet werden können, Inuit jagen Robben vom Schneemobil aus und im Regenwald Ureinwohner Affen mit Giftpfeilen. Tierschutz spielt in manchen Ländern, in denen die Lebensmittelbeschaffung als Motivation der Jagd noch im Mittelpunkt steht, oft eine untergeordnete Rolle. In Deutschland hat sich die Jagd, ausgehend vom Reichsjagdgesetz von 1934, zur Hegejagd entwickelt, die ein Dutzend jagdbare Wildtierarten (von über 45.000 Tierarten) in den Mittelpunkt einer züchterischen und produktionsorientierten Wildbewirtschaftung gestellt hat. Aus Sicht der 1930-er Jahre vielleicht nachvollziehbar, da die Wilddichte teils extrem viel geringer war als heute und Rothirsch und Wildschwein durch Schutz und Hege gefördert werden sollten.
Heute aber gibt es bei uns mehr Hirsche, Rehe und Wildschweine denn je. Das Schalenwild kommt in derart hohen Dichten vor, dass landauf, landab erhebliche Probleme verursacht werden. In Land- und Forstwirtschaft, aber auch in der Natur: Rehe und Hirsche verhindern derzeit die natürliche Regeneration unserer kranken Wälder und unterbinden somit die derzeit wichtige Resilienz (Regenerationsfähigkeit) intakter Ökosysteme – und das (fast) flächendeckend in Deutschland!
Nun soll das Bundesjagdgesetz, gemäß des Koalitionsvertrages von CDU/CSU und SPD, geändert werden. Es geht um Büchsenmunition, Schießnachweis und Jungjägerausbildung. Aber auch um das Thema Wald und Wild, wie Ministerin Julia Klöckner (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL) in ihrem Eckpunktepapier auf dem Waldgipfel im Herbst 2019 angekündigt hat. Die teils katastrophalen Wildschäden in den Wäldern sind in den letzten Jahren klar erfasst und beschrieben worden und können von den Jagdverbänden nicht mehr weggeredet werden. Dadurch ist der Druck der Wald-, Umwelt- und Forstverbände so stark geworden, dass offensichtlich ein Kipppunkt zugunsten der Waldvertreter erreicht wurde. Der „Wissenschaftliche Beirat Waldpolitik“ des BMEL hat dem Ministerium in seiner Stellungnahme zur Nationalen Waldstrategie 2050 bereits einen jagdlichen Paradigmenwechsel („grundlegende Neuausrichtung“) angeraten und empfiehlt der Ministerin – zugunsten einer waldfreundlichen Jagd - die komplette „Entrümpelung“ des aktuellen BJagdG und die Beendigung von Hegejagd und Wildbewirtschaftung.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Einer Stellungnahme vom Deutschem Jagdverband (DJV), Wildtierstiftung und Berufsjägern (BDB) folgte ein „Brandbrief gegen jagdfeindliche Bemühungen“ (JAEGERMAGAZIN online 7.5.2020). Reflexhaft wurden von wütenden Jägern altbekannte Parolen auf Stammtischniveau durchs Netz gebrüllt („Schalenwild ohne Lebensrecht. Ein wildfeindliches Bundesjagdgesetz.“ etc.), und die Gräben weiter vertieft. Inhaltlich bieten die Verbände nichts an, außer die seit Jahrzehnten propagierten Lösungsvorschläge: Da es eh nur lokale Probleme gäbe, könnten diese eigenverantwortlich von den Jägern vor Ort gelöst werden. Dass dies seit Jahren nicht funktioniert, zeigen Wildschäden und Streckenstatistik mehr als deutlich und im ganzen Land. Und dass die Idee mit der Freiwilligkeit und Eigenverantwortung überall dort nicht funktioniert, wo monetäre Interessen mit Tier- oder Naturschutz kollidieren (vgl. Heute 2018: „Der große Reibach“; s. links), sieht man eindrucksvoll in der ausgeräumten, bald insekten- und niederwildlosen Agrarlandschaft oder aktuell in der Fleischverarbeitung der Massentierhaltung.
Dass die Deutungshoheit über die Jagd zugunsten derjenigen gekippt ist, die den Zustand von Wäldern und Feldern vor die Interessen weniger Jagdpächter stellen, lässt sich daran erkennen, dass es eben nicht nur „grüne Ideologen“ sind, die einen Paradigmenwechsel in der Jagdpolitik fordern. Es ist das CDU geführte BMEL unter Führung von Julia Klöckner, die das Ziel Naturverjüngung im BJagdG festschreiben, Abschusspläne für Rehwild abschaffen und Kontrollmöglichkeiten durch Jagd- und Forstbehörden erweitern will (laut wildundhund.de 19.5.2020). Nur zur Erinnerung: Es war auch eine CDU-Kanzlerin, die am Ende das grüne Flaggschiff Energiewende enterte und die AKW’s abschalten ließ, nachdem Fukushima den Kipppunkt endgültig in die „grüne Richtung“ hatte schlagen lassen.
Mittlerweile sind sich alle an der Diskussion beteiligten Verbände und Institutionen, von Landwirtschaft und Forst über Naturschutz bis zu den Jagdverbänden darin einig, dass die Jagd eine entscheidende Rolle bei Wildschadenverhütung und Seuchenprävention spielt. Und inmitten der fortschreitenden Diskussionen darüber, wie die Jagd der Zukunft aussehen soll (z.B. so wie es wenige Beispielbetriebe seit Jahren vormachen), möchten DJV und Berufsjäger die deutsche Jagd zum UNESCO-Weltkulturerbe erklären lassen! Die Botschaft ist deutlich: Die deutsche Jagd ist die beste der Welt und soll sich nicht ändern. Diese Art der Jagd, nämlich die Hege und Bewirtschaftung von Wildtieren, hat dazu geführt, dass sich der komplette Wald in Deutschland nicht artenreich verjüngen kann. Außerdem ist „die“ deutsche Jagd in den letzten Jahren sehr vielfältig geworden. Junge Jagdblogger, ANW-Förster und jagende Naturschützer zeichnen heute ein ganz anderes Bild der „deutschen Jagd“, als es den Antrag stellenden Verbänden lieb ist.
Die „deutsche Jagd“ ist so reformbedürftig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Einige Länder haben, übrigens unabhängig von der Farbe der Regierungskoalitionen, bereits teils fortschrittliche neue Landesjagdgesetze erlassen. Die Jagd steht vor grundlegenden Umwälzungen, ob die Verbände wollen oder nicht, denn die angeblichen Partner des ländlichen Raums spielen immer weniger mit. Die Forstwirtschaft schon lange nicht mehr und auch die Landwirtschaft fordert verstärkt Lösungen der Schwarzwildproblematik ein. In der Wagenburg wird es einsam, auch weil sich die junge Jägergeneration zunehmend von der Traditionsjagd abwendet. Und der gesellschaftliche Druck wird mit der Waldkrise und den hohen Wildbeständen weiter anwachsen.
Wer in so dynamischen Zeiten wie diesen heute immer noch meint, alles könne bleiben wie es ist, ist sehenden Auges ins Abseits gelaufen. Und muss damit rechnen, dass man am Ende abgehängt und die Zeitenwende von anderen gestaltet wird.
Kolumne vom 1.4.20
Jagd trotzt Corona
Man möchte es kaum noch ansprechen, geschweige denn zum Thema der ersten JAGD-HEUTE- Kolumne machen, doch die Coronakrise wirft ihre langen Schatten auch auf die Jagd. Zwar fällt diese unselige Zeit der Kontaktverbote glücklicherweise nicht in die Treib- und Drückjagdsaison. Doch drohende Ausgangssperren könnten theoretisch jedwede Jagd unmöglich machen. Um dieses gerade für viele Männer kaum vorstellbare Horrorszenario zu verhindern, hat der Deutsche Jagdverband – gewohnt breitbrüstig - die Jagd in einer Pressemitteilung kurzerhand zur „systemrelevanten Daseinsvorsorge“ für die Landwirtschaft erkoren! Was für ein Ritterschlag! Denn damit werden die Jäger auf ein Schild gehoben, das sie mit den wichtigsten, weil tragenden Säulen der Gesellschaft, den Ärzten, Pflegern, Politikern und Polizisten, teilen. Damit macht sich die Jagd mal eben so „systemrelevant“ und unverzichtbar wie die ärztliche oder die Grundversorgung. Der Deutsche Jagdverband begründet die Forderung nach der exponierten Stellung der Jäger/innen übrigens mit
- dem „Kampf gegen die Ausbreitung der ASP“
- dem Verhindern „großer Ernteausfälle“
- der Nutriajagd an Deichen
- sowie der Notwendigkeit regelmäßiger Nachsuchen nach Wildunfällen.
Doch ob hier wirklich Systemrelevanz vorliegt wird sich erst noch zeigen. Denn so wie die aktuelle Gesundheitskrise der Gesellschaft einen harten Charaktertest unterzieht, werden die vollmundigen Begründungen des Jagdverbands für eine unverzichtbare Jagd sich den aktuellen, teils akuten Problemherden stellen und sich messen lassen müssen! Sonst heißt es später „Große Klappe, aber nichts dahinter…“. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL; Julia Klöckner) "betrachtet die damit ausgesprochene Privilegisierung der Jägerschaft gegenüber anderen Teilen der Bevölkerung als hohe Anerkennung, zugleich aber auch als gesellschaftlichen Auftrag für einen konkreten Beitrag, insbesondere zur Sicherung der Ernährungsvorsorge der Bundesrepublik Deutschland".
Rückblickend sind die Erfolge der Jagd, wie sie auf überwiegender Fläche in Deutschland ausgeübt wird, überschaubar. Nachdem man jahrzehntelang den Ersatzmann für die ausgestorbenen Bären, Wölfe und Luchse gemimt und vorgegeben hat, die Jäger würden die Wildbestände regulieren, stellt sich seit den 1990-er Jahren immer drastischer heraus, dass die Jäger eben nicht regulieren, geschweige denn reduzieren. Sie jagen stets im kompensatorischen Bereich, was in schweren Zeiten gut und nachhaltig ist (z.B. derzeit bei Hasen), in Zeiten von angezeigten Reduktionsanschüssen aber nicht wirkt. Die Abschüsse verhindern nur, dass die Bestände nicht noch rasanter anwachsen. Leider hat diese Art der Jagd und ihre grundfalsche, oft auch fadenscheinige Begründung zu einem stark ramponierten Image in der Gesellschaft geführt.
Bemerkenswert ist in diesen Tagen auch, dass es plötzlich einen breiten Konsens darüber gibt, dass unsere Hirsche und Rehe stärker bejagt werden müssen, wenn sich die derzeit geschätzt 250.000 Hektar „Kalamitätsflächen“ artenreich wieder bewalden können sollen. Zwar hat der Landesbetrieb Wald und Holz NRW zum großen Teil schon vor den Jägern oder unwilligen Forstbediensteten kapituliert und manche Revierförster legen im Zäunungen im Landeswald an, obwohl der Zaunbau im Rahmen der WIederbewaldung per Betriebsanweisung verboten wurde. Aber selbst Verbände, die eine zielgerichtete, wildschadenorientierte Jagd über Jahrzehnte strikt abgelehnt hatten, stimmten der Schonzeitaufhebung für Böcke und Schmalrehe in NRW zu. Damit ist in der Wald-Wild-Debatte endlich die dritte (und letzte?) Stufe der Auseinandersetzung erreicht: Nachdem die Ökojagd-Szene zunächst belächelt (1970-er und 80-er Jahre) und später vehement bekämpft wurde (Diffamierungen und Denunziation), wird die Dringlichkeit nun, besser spät als nie, zähneknirschend anerkannt. Das Dogma der Hege- und Bewirtschaftungsjagd wankt stärker denn je - und wird bald Vergangenheit sein.
Der Bau von Zäunen - v. a. zum Schutz der Felder vor Schwarzwild - wird von Jägern in ganz Deutschland betrieben und soll "systemrelevant" sein. Komisch nur, dass die Anerkennug für eine solch existentiell wichtige Arbeit oft ausbleibt.
Für den naturnahen Wald ist eine zeitgemäße Jagd sogar nachweislich "systemrelevant". Doch viele "traditionelle" Jäger lehnen diese aus Prinzip ab und verhindern damit Wildregulation auf größerer Fläche.