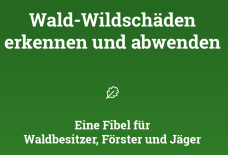Diskussion/ Fazit Rehwildprojekt
Wildverbiss ist nicht allein ein forstliches Problem, wie oft dargestellt wird. Dabei wird argumentiert, dass Rehe und Hirsche soviel verbeißen dürfen, wie sie mögen, solange nur genug Individuen derjenigen Art(en) überleben, die der Eigentümer als Betriebsziel definiert hat. Ein Zielbestand aus Buche und Douglasie etwa ist vergleichsweise leicht auch bei hohen Schalenwildbeständen erreichbar. Für den Körperschafts-, Kommunal- und Staatswald darf es allerdings keine Rechtfertigung für überhöhte Wildbestände sein, dass man nur wenige Baumarten kultivieren will. Für ihn gelten andere Prioritäten: „Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatswaldes … dient der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse“ (Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 31.5.1990: s. Blank et al., 2021). Somit stehen in diesen Wäldern die Sicherung der Ökosystemleistungen und das „fit machen“ für den Klimawandel an erster Stelle. Grundbedingung hierfür ist, dass sich die Wälder jederzeit, rasch und artenreich verjüngen bzw. erneuern können. Auch die meisten privaten Waldbesitzer hoffen auf ihren Flächen auf einen möglichst artenreichen Wald. Die Projektergebnisse zeigen auf, dass veränderte Bejagungsstrategien den Wildverbiss deutlich reduzieren können. Die positiven Auswirkungen beziehen sich nicht nur auf einzelne Baumarten, sondern v. a. auf das Ökosystem Wald und damit auf das Potential der Wälder hinsichtlich ihrer Ökosystemleistungen.
Die Dichte des verbeißenden Schalenwildes ist ausschlaggebend für das Ausmaß der Wald-Wildschäden bezüglich Baumartenvielfalt und Diversität (Gill&Beardall 2001, Ammer 2009). Daher ist es problematisch, dass die Rehwilddichte von Jägern regelmäßig teils drastisch unterschätzt wird (Gossow 1976, Hespeler 2016). Zwar sind Rehe in der Jagdpraxis nicht zählbar, doch noch heute wird in der Jungjägerausbildung gelehrt, wie hoch „tragbare Dichten“ maximal sein dürfen. Für Rehe wurden von der Wildbiologie Werte von zwei bis zwölf Rehen pro 100 Hektar als tragbar eingestuft (Ueckermann 1951, Mottl 1956, Grigorov 1977, Stubbe 1988), d. h. mehr als zwölf Rehe/ 100 ha wurden als „untragbar“ angesehen. Über Jahrzehnte wurden diese Zahlen nicht angezweifelt. Heute leben in den Revieren NRW’s - wie in anderen Bundesländern auch - regelmäßig Frühjahrsbestände von mindestens 40, in strukturreichen Revieren z. T. auch 50 bis 60 und mehr Rehe pro 100 Hektar (vgl. Wotschikowsky 1996, Pegel 1998, Hespeler 2016, Sperber&Panek 2021). Das sind mindestens drei- bis viermal mehr Rehe als für den Lebensraum Wald tragbar sind.
In den meisten Revieren wird Rehwild immer noch traditionell gejagt. Diese selektive, meist an Trophäen orientierte Hegejagd findet ausschließlich im kompensatorischen Bereich statt (d. h. es wird Jahr für Jahr weniger erlegt als „nachwächst“) und wirkt daher nicht regulierend. Der Grundbestand des Rehwildes wird nie reduziert, so dass sich die Bestände allmählich immer weiter aufbauen, wie es die Streckenstatistik für NRW zeigt. Mit der Folge, dass die Rehwilddichte derzeit wahrscheinlich so hoch ist wie nie zuvor. Die neue Rekordstrecke von 115.362 Rehen für NRW im Jagdjahr 2020/21 verdeutlicht die Situation.
Da die Rehwildbestände so hoch sind wie noch nie, ist auch der Verbissdruck auf die Waldverjüngung so hoch wie nie. Auf der einen Seite ist die herkömmliche Jagd auf den Rehbock vom Ansitz so leicht wie nie, auf der anderen Seite ist eine effektive, d. h. regulierende Rehbejagung heute aufwändiger und anspruchsvoller denn je. Der Zeitpunkt, an dem die Rehbestände leicht hätten reguliert werden können, liegt mindestens dreißig Jahre zurück (Abb. 10).
Jagd im Forschungsrevier
Im Forschungsrevier „RVR Ruhr Grün - Eilper Berg“ wurden die Strecken im Projektzeitraum deutlich gesteigert bis auf 23 Rehe pro 100 Hektar im Jagdjahr 2021/22. Dennoch kann man davon ausgehen, dass der Rehwild-Grundbestand (Frühjahrsbestand vor der Setzzeit) nicht wesentlich reduziert wurde. Eingriffe von bis zu 25 Rehen pro 100 Hektar sind in strukturreichen Waldrevieren wie im Forschungsrevier offensichtlich kompensatorisch. Das heißt, bei Strecken von bis zu 25 Rehen pro 100 Hektar wird weniger erlegt als jährlich „nachwächst“. Bei Reproduktionsraten des Rehwildes von bis zu 100 % (in Revieren mit deutlich mehr Ricken als Böcken, wie hier zu Anfang des Projektes) verdoppelt sich der Bestand im Frühjahr. Sind sonstige Mortalitätsfaktoren gering, müsste man also mindestens jedes zweite Reh erlegen, wenn der Bestand reduzieren werden soll.
Die anhaltend hohen Streckendaten sowie die Weiser Konstitution, Vorkommen von Rachendasseln und das Knopfbocksyndrom stützen diese Hypothese (vgl. Stubbe 1997). Auch konnte trotz der hohen Eingriffe im Laufe der Projektjahre keine Verbesserung der Konstitution der Rehe festgestellt werden.
Mit den Eingriffen von ca. 20 Rehen pro 100 ha im Forschungsrevier könnte in etwa die jährliche Reproduktion abgeschöpft worden sein. Was den positiven Effekt hatte, dass die Dichte temporär – für die „verbissempfindlichste“ Zeit von Januar bis April – unter die Kapazitätsgrenze gedrückt wurde, ab der keine irreversiblen Schäden mehr stattfinden. Sprich, ab dieser Winterdichte werden die Pflanzenarten der Krautschicht nicht mehr entmischt und die Rehe wirken nicht mehr als Begrenzer der Vielfalt.
Mit der Steigerung der Strecke innerhalb des Projektzeitraumes sank der Verbiss (über alle Baumarten) von 41 % in 2017 auf 11 % in 2021 (Abb. 11). Man kann erwarten, dass der Verbissdruck auf die Vegetation und die Entmischung umgehend wieder zunehmen würde, sobald die Bejagungsintensität nachließe.
Es kann davon ausgegangen werden, dass allein der erhöhte Abschuss ursächlich für den signifikanten Rückgang des Verbisses ist. Denn andere Faktoren, die sich positiv auf die Verbissentwicklung hätten auswirken können - wie deutlich verbesserte Nahrungsbedingungen - veränderten sich im Projektzeitraum kaum. Zwar ist das Revier auch von der Fichtenkalamität betroffen, doch wurde erst ab April 2020 mit der Aufarbeitung der Flächen begonnen. Auf den Kahlflächen entwickelte sich in den ersten beiden Jahren noch keine üppige Krautschicht, die als Äsung für das Rehwild in nennenswertem Umfang zur Verfügung gestanden hätte, geschweige denn, dass sie den Winterverbiss abgepuffert hätte. In den nächsten Jahren wird die Äsungskapazität jedoch sprunghaft ansteigen und auch mit der Etablierung der Brombeere auf den Flächen wird sich der Verbiss verteilen. Es wird wichtig sein, das Rehwild in den ersten Jahren weiterhin intensiv zu bejagen, um das Naturverjüngungspotential der Kalamitätsflächen zu sichern.
Die nicht selektive, konsequente Rehbejagung im Forschungsrevier führte zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis. Durch die intensive Bejagung kommt es zudem zu einem hohen Eingriff in die Jugendklasse und damit zu einer natürlichen Altersklassenverteilung beim Abschuss und zu einer natürlichen demographischen Altersstruktur im Rehwildbestand. Im Gegensatz hierzu sind die Alterspyramiden nach Bewirtschaftungsidealen als Produkte der trophäenorientierten Wildbiologie unnatürlich (Hespeler 2016). Schon lange ist bekannt, dass der Wahlabschuss eine unnatürliche Streckengliederung der Altersklassen bedingt (Kurt 1991). Dennoch wird der Wahlabschuss in vielen Jagdschulen bis heute gelehrt und in vielen Revieren praktiziert.
Bei vielen Beobachtern (Anwohnern, Jagdgenossen, Jagdnachbarn) entstand in der zweiten Projekthälfte der Eindruck, als seien kaum noch Rehe im Revier, weil die Beobachtbarkeit der Rehe auf den Wiesen im Laufe der Jahre deutlich abnahm. Während zu Projektbeginn regelmäßig auch tagsüber mehrere Rehe auf den Wiesen beobachtet werden konnten (bei relativ geringer Fluchtdistanz), sah man nach drei, vier Jahren auf den Wiesen nur noch selten Rehe bei Tageslicht. Nachts konnten jedoch auch im fünften Jahr noch bis zu sieben Rehe gleichzeitig - und damit etwa so viele wie zu Projektbeginn - per Wärmebildkamera bestätigt werden. Dass die Rehe tagsüber nicht mehr so erlebbar sind, ist für viele (Spaziergänger, Anwohner, Kinder) sicherlich bedauerlich. Allerdings ist es eher ein Zeichen von Naturnähe, wenn sich nicht andauernd Rehe auf den Wiesen beobachten lassen. Bei angepassten Dichten halten sich Rehe, als ursprüngliche Waldart, fast ausschließlich im Wald auf. Das sorglose Äsen von Rehen weitab vom Waldrand im Offenland ist kein „natürliches“ Verhalten und zeigt, dass es für Rehe keine naturnahe „landscape of fear“ gibt. Würden Wolf und Luchs im Revier jagen (oder eben der Mensch intensiv), wagten die Rehe sich nicht vom Waldrand zu entfernen.
Dass trotz der intensivierten Jagd auch im fünften Jahr noch genauso häufig Rehe vom Ansitz gesehen wurden wie im zweiten Projektjahr, ist sicherlich etwas überraschend. Konnte man doch damit rechnen, dass der Aufwand pro erlegtem Reh größer werden müsste. Und tatsächlich wurde es im Laufe der Jahre – zumindest im Vergleich mit dem ersten Jahr – schwieriger, Rehwild zu erlegen. Auf den Wiesen wurden die Rehe signifikant weniger beobachtet und im Wald agierten sie zunehmend vorsichtiger (so zumindest unsere subjektive Wahrnehmung). Dass in den letzten Projektjahren trotzdem etwa gleich viele Rehe von den Ansitzen aus gesehen wurden (Anblicke pro Ansitz) ist auch darauf zurück zu führen, dass zum Detektieren der Rehe zunehmend Wärmebildgeräte eingesetzt wurden. Zusätzlich kommt hinzu, dass in den letzten beiden Jahren einige frische Kalamitätsflächen neue Möglichkeiten boten und von hohen Hochsitzen aus sehr effektiv eingesehen und bejagt werden konnten.
Die zunehmende Schwierigkeit bei der Bejagung wurde kompensiert, indem die Qualität der Jäger im Laufe der Projektzeit kontinuierlich gesteigert wurde. Wichtige Faktoren sind dabei professionelles Verhalten, Handlungsschnelligkeit und sicheres Schießen. Ein reibungslos funktionierendes Jagdteam ist, neben dem Netz der Ansitzeinrichtungen, die Grundlage für die erfolgreiche Bejagung eines Waldrevieres. Besonders effektiv kann gejagt werden, wenn die Begehungsscheininhaber und „Jagdhelfer“ ohne Jagdneid und auf Augenhöhe - auch mit dem Jagdleiter - gemeinsam jagen. Optimal ist es, wenn sich in der Gruppe ein positiver „Teamgeist“ entwickelt.
Ebenfalls entscheidend waren die zwei (!) professionellen Drückjagden mit hoher Intensität sowie der großzügigen Freigabe, wonach Rehe uneingeschränkt erlegt werden konnten. Die Freigabe von Böcken führte nicht dazu, dass im folgenden Frühjahr kaum noch Böcke da gewesen wären, aber es erleichtert das Erlegen eines Rehes auf einer Drückjagd ungemein, da das Reh vor dem Schuss nicht auf das Geschlecht angesprochen werden muss.
Gerade im Zusammenhang mit Bewegungsjagden wird oft der gesetzlich verankerte und bei den Jägern selbstverständliche Muttertierschutz diskutiert. Dabei wird häufig missverständlich der Begriff der zu schonenden „führenden Stücke“ angeführt. Denn es dürfen nur diejenigen Muttertiere nicht geschossen werden, die für die Aufzucht bis zum Selbständigwerden der Jungtiere notwendig sind. Nachdem z. B. Frischlinge mit dem verschwinden der Frischlingsstreifen mit ca. vier Monaten oder Rehkitze mit der abklingenden Säugezeit im Herbst nicht mehr auf die Muttertiere angewiesen sind, dürfen die zugehörigen Bachen bzw. Ricken erlegt werden.
Die Vorgabe „jung vor alt“ macht – abgesehen davon, dass diese Maßgabe „Ehrenkodex“ unter den Jägern sein dürfte – bei Bewegungsjagden auf Rehwild wenig Sinn: Ricke und Kitz trennen sich vor Hunden auf Drückjagden fast immer. Zum Zeitpunkt der Bewegungsjagden im November haben die Rehkitze bereits die wichtigsten Dinge von der Ricke gelernt: Sie kennen sichere Ruheplätze, Äsungsstellen und wissen, wie man Gefahren ausweicht. Der wichtigste deutschsprachige Rehwildforscher Helmuth Wölfel schreibt: „Für Rehkitze ist … der Verlust der Geiß im Spätherbst für die Entwicklung weitgehend bedeutungslos: Es entstehen dadurch nicht die vermeintlichen Knopfböcke oder schwachen Schmalrehe“ (Wölfel 2015). Ab November ist der Abschuss einer führenden Ricke daher unbedenklich (vgl. MELRV BW).
Dass Rehe den Verlust der Ricke riskieren, indem sie sich auf Bewegungsjagden sehr häufig bei Gefahr von ihren Kitzen trennen (auch schon im Oktober/ November) zeigt eines: Der in der Natur nachsetzende Wolf oder Luchs folgt einer der beiden Fährten. Ob er der Ricke folgt oder einem Kitz weiß der Prädator nicht. Die Ricke nimmt also „in Kauf“, dass es sie selbst erwischt und nicht das Kitz. Dieses Verhalten wäre unsinnig, wenn das Kitz nach dem Verlust der Ricke nicht überlebensfähig wäre. Beim Rotwild sehen wir daher das gegenteilige Verhalten: Die noch lange auf das Muttertier angewiesenen Kälber lassen sich auf Bewegungsjagden kaum vom Alttier trennen. Sie kleben förmlich am Muttertier, um nicht zu verwaisen.
Ein wesentlicher Faktor für die auch im fünften Jahr noch effizienten Drückjagden war der Einsatz ausreichend vieler und geeigneter, spurlauter Hunde (vgl. Lang et al., 2010). Bei geringer Rehwilddichte und bereits erfahrenen Drückjagdrehen (und ggf. nasser, windiger Witterung) ist es oft sehr schwer, die Rehe zu mobilisieren. Der ausreichende Hundeeinsatz ist daher gerade auch bei niedrigeren Wilddichten besonders wichtig (vgl. Ruusila&Pesonen 2004). Es ist allerdings absehbar, dass sich der jetzt schon existente Mangel an guten Stöberhunden weiter verschärfen wird.
Der Arbeitsaufwand, den ein Jagdteam bei konsequenter Waldjagd leistet, ist sehr viel höher als der Arbeitsaufwand, der im konventionell bejagten Waldrevier durchschnittlich betrieben wird. Für das Jagdjahr 2018/19 wurden vom Jagdteam knapp 500 h Arbeitszeit im Revier geleistet (41,7 h im Monat), v. a. für die Errichtung der Ansitze, freischneiden von Schussschneisen und Vorbereitungen der Drückjagden. Die größten Unterschiede zum konventionell bejagten Revier bestehen im Aufbau und Unterhalt der Hochsitz-Infrastruktur. Mit 20 Ansitzeinrichtungen pro 100 Hektar oder sogar mehr sind mehr als doppelt so viele Ansitze zu finanzieren, bauen und unterhalten. Auch der Aufwand für die Drückjagden unterscheidet sich erheblich von herkömmlich bejagten Revieren: Auf den Jagden im Forschungsrevier kamen vier- bis fünfmal mehr Personen und Hunde zum Einsatz als durchschnittlich in vergleichbaren Nachbarrevieren. Auch die Häufigkeit der Ansitze – mit bis zu einem Ansitz pro Hektar Revierfläche – dürfte deutlich höher liegen. Insgesamt dürfte der Arbeitsaufwand für die zielorientierte Betreuung und Bejagung eines Waldrevieres mindestens drei- bis viermal höher sein als in herkömmlich bejagten Revieren.
Dass die Regiejagd für die Eigentümer sehr arbeitsaufwändig und i. d. R. kostspielig ist, wurde von den Netzwerkrevieren bestätigt. Für den Landesbetrieb Wald und Holz NRW beziffert Meier (2018) den Arbeitsaufwand für die Regiejagd auf 0,8 h pro Hektar Revierfläche. Für ein Revier durchschnittlicher Größe von 280 ha (wie dem Forschungsrevier) bedeutet dies einen Aufwand von 224 h, die durch den Förster und die Forstwirte geleistet werden müssen. Bei einem so hohen Aufwand ist es umso wichtiger, dass die investierte Arbeit auch zum Erfolg führt (Monitoring) und nach einigen Jahren deutliche Erfolge sichtbar werden. Die Regiejagdfläche sollte für den Förster daher nicht zu groß sein und richtet sich auch nach der Qualität des Jagdteams.
Am Beispiel des Hochsitzbaus wird die hohe Arbeitsintensität deutlich, die die konsequente Revierbejagung notwendig macht. Um so rasch wie möglich effektiv jagen zu können, müssen nach Übernahme eines Revieres gleich im ersten Jahr oft zahlreiche Sitze gebaut und gestellt werden, um möglichst schnell eine geeignete Infrastruktur für die Ansitz- und Bewegungsjagden nutzen zu können.
Oft ist von einer annähernden „Unbejagbarkeit“ der Reviere aufgrund von Beunruhigungen durch Erholungssuchende und Freizeitsportler zu hören. Im Forschungsrevier konnte dieser Effekt nicht bestätigt werden. In dem stadtnahen Revier, unmittelbar vor den Toren der Ruhrmetropole, haben Wanderer, Spaziergänger mit Hunden, Geocacher, Mountainbikefahrer, Reiter oder Pilzpflücker weder die Rehe an einer hohen Siedlungsdichte, noch uns an einer effektiven Bejagung gehindert. Der regelmäßige Kontakt mit den Anwohnern/ Spaziergängern hat im Gegenteil zu viel gegenseitigem Verständnis geführt. Aus der Haltung heraus, dass die Jagd ein Nutzen der Natur ist bzw. (Dienst-) Leistung für den Wald und nicht elitäres Jagdvergnügen, traten die Jäger den Spaziergängern stets freundlich und demütig entgegen. Ihnen wurde erklärt, warum hier wie gejagt wird. Die Jagd stieß bei vielen Anwohnern auf großes Interesse und unsere Erklärung, dass intensiver gejagt werden muss, um Schäden im Wald zu verhindern, wurde ausnahmslos akzeptiert. Viele Anwohner wurden begeisterte Abnehmer von Wildbret aus dem Revier.
Häufig wird im Zusammenhang mit der „richtigen“ Bejagung der von der Kalamität betroffenen Reviere eine „Schwerpunktbejagung“ der Verjüngungsflächen bzw. aufgeforsteten Flächen empfohlen und suggeriert damit, dass es ausreiche, an den Flächen jagdlich präsenter zu sein, um dort das eine oder andere Reh mehr zu schießen. Eine solche Schwerpunktbejagung wird, wenn überhaupt, in den meisten Revieren nur sehr extensiv durchgeführt. Im besten Fall wird ein Sitz an die Fläche gestellt, der etwas häufiger besetzt wird als andere Sitze. Mit dem Ergebnis, dass hier ein bis zwei, vielleicht auch drei oder vier Rehe geschossen werden, die sonst nicht erlegt worden wären. Bei hohen Rehdichten wirkt sich diese gezielte Bejagung aber kaum auf die Verbisssituation aus. Die für das Rehwild attraktiven Flächen werden immer wieder von verschiedenen Rehen aufgesucht. Bei häufigen Störungen durch die Ansitzjagd verlagern die Rehe ihre Aktivität fast ausschließlich in die Dämmerung und die Nacht. Dass es nicht ausreicht, eine Fläche „zu bewachen“, indem man dort besonders häufig sitzt (aber eben nicht in 365 Nächten im Jahr), zeigte uns eine Kalamitätsfläche im Forschungsrevier. Auf dieser wurde im Juli 2020 ein hoher Hochsitz gebaut und fortan besonders oft besetzt, weil es ein besonders aussichtsreicher Standort ist. Dies bestätigte sich und es wurden von diesem Sitz in den ersten zehn Monaten acht Rehe erlegt. Im anschließenden Sommer/ Herbst 2021 wurde dann festgestellt, dass trotz des hohen Eingriffs immer noch regelmäßig bis zu fünf Rehe auf der Fläche standen, die meist aber nur noch sehr spät in der Dämmerung mit der Wärmebildkamera entdeckt wurden. Außerdem mussten wir registrieren, dass der Verbissdruck auf der Fläche weiterhin hoch war. Ein Weisergatter auf der Fläche konnte zeigen, dass es nach wie vor einen hohen Keimlingsverbiss gab bis hin zur fast völligen Entnahme der Eichen sowie die komplette Entnahme der Weidenröschen auf der 4,5 Hektar großen Fläche.
Der Verweis auf die Schwerpunktbejagung der Kalamitätsflächen ist überflüssig: Im konsequent bejagten Revier wird sowieso an jede Kahlfläche mit aussichtsreichem Schussfeld ein Sitz gestellt. Diese werden so oder so in den ersten Jahren häufiger besetzt als andere Sitze, da dies i. d. R. besonders Erfolg versprechende Stellen sind. Entscheidend ist nicht, dass an einzelnen Zielflächen konzentriert gejagt wird, sondern dass die Gesamtdichte des Rehwilds im Revier bis zum Winter deutlich gesenkt wird, so dass der Verbissdruck in dieser Zeit gering ist.
Vegetationsmonitoring
Je artenreicher ein Wald ist, desto widerstandsfähiger und damit auch risikoärmer ist er für die Eigentümer (Zimmer&Helfer 2016, Brockerhoff et al. 2017, Thompson et al. 2009, Danescu et al. 2016, Liang et al. 2016).
In NRW führt intensiver Verbiss bei den Baumarten jedoch zu einer Förderung der Arten Buche, Birke und Fichte und einer Benachteiligung der Arten Traubeneiche, Stieleiche, Bergahorn, Esche, Elsbeere, Mehlbeere, Speierling, Bergulme, Holzapfel, Hainbuche, Vogelkirsche, Eberesche, Salweide, Aspe, Flatterulme, Erle, Feldulme, Winterlinde, Sommerlinde und Bruchweide (vgl. Bieker&Heute 2021, Simon 2016, Briedermann 1991, Ellenberg 1994, Ammer 1996, Keidel et al., 2008, Striepen 2013).
Dabei „verkraften“ Reviere mit ärmeren Böden und geringer Wuchskraft weniger verbeißendes Schalenwild als Reviere mit guten, „wüchsigen“ Böden, wie z. B. dem Netzwerkrevier Salm-Boscor (Muschelkalkböden). Nicht nur im Forschungsrevier Eilper Berg, auch in fast allen Netzwerkrevieren schwacher Standorte konnten sich trotz ausreichender Lichtverhältnisse, vorhandener Mutterbäume und mehrerer voran gegangener Mastjahre keine Eichen verjüngen. Hohmann et al. (2018) berichten sogar vom Totalausfall der Eiche bei Schalenwilddichten von nur drei bis vier Stück Rotwild und ca. fünf Rehen pro 100 ha im Pfälzerwald. Im parallel zum Forschungsprojekt stattgefundenen, bundesweiten BioWild-Projekt waren 20,5 % aller Buchen, 38,4 % der Weichhölzer sowie 59,6 % aller langlebigen Laubhölzer verbissen (von der Goltz 2021).
Häufig wird bei ausbleibender Naturverjüngung argumentiert, es fehle an nahestehenden Mutterbäumen. Zum Beispiel könnten auf einer Kalamitätsfläche, die komplett von Fichtenforst umgeben ist, kaum andere Arten siedeln, da die Samenbäume fehlten. Aus den Erfahrungen nach Kyrill (Heute 2017) und von Weisergattern wissen wir aber, dass z. B. alle Kahlflächen auf unseren Hainsimsen-Buchenwald-Standorten (fast das gesamte Bergische Land, Sauer- und Siegerland) von den charakteristischen Pionier- und Begleitbaumarten Birke, Eberesche, Salweide und Aspe besiedelt werden. Und auch Buchen und Eichen besiedeln die Flächen i. d. R. problemlos, sofern der Rehwildbestand angepasst ist oder die Fläche gezäunt: Buchen besiedeln leicht Flächen, die 300 m entfernt vom Samenbaum liegen. Eicheln werden von Hähern problemlos in 500 m weit entfernte Böden gesteckt. In regelmäßigen Ausnahmen bzw. Extremen werden noch deutlich weiter entfernte Flächen besiedelt (Ethz 2016). So gut wie alle Kalamitätsflächen werden daher auch mit Eichen aus Hähersaat besamt.
Das Vegetationsmonitoring am Eilper Berg hat gezeigt, dass bei einem Laubholz- Verbissprozent (über alle Baumarten) von 49 % zu Projektbeginn eine komplette Entmischung der Naturverjüngung bis auf die Arten Fichte, Buche und Birke (sowie Douglasie aus Kunstverjüngung) stattgefunden hat. Erst mit dem Senken des Laubholz- Verbissprozentes auf 12 % konnte erreicht werden, dass sich mehr Arten, z. B. die wichtigen Arten Bergahorn und Esche, festsetzen konnten (d. h. ausreichend viele Individuen erreichen eine Höhe von 120 cm). Besonders verbissempfindliche Arten (Eiche, Hainbuche) und seltene, verbissempfindliche Arten (z. B. Kirsche) konnten sich bislang aber noch immer nicht etablieren. Zudem findet trotz des relativ geringen Verbissprozentes nach wie vor eine deutliche Entmischung im Keimlingsstadium statt, wie die Weisergatter bzw. deren Referenzflächen zeigen. Seltenere Gehölzarten sind durch Verbiss besonders gefährdet, komplett entmischt zu werden (vgl. Ergebnisse des Biowild-Projektes; Vor&Ammer 2021). Obwohl im Revier ein (gefühlt) guter Hasenbesatz vorkommt, spielt der Verbiss von Hasen (< 1 %) keine Rolle im Verhältnis zum Rehwildverbiss.
Die Verbiss-Toleranzwerte des Landes NRW (Abb. 8) scheinen zu hoch zu sein. Nach Einschätzung der vorliegenden Ergebnisse dürften Verbissprozente von 20 % bis 25 % bereits zu einer „erheblichen Gefährdung“ der Baumart führen und Prozente von 12 % bis 15 % sind für seltenere, verbissempfindliche Baumarten wie die Vogelkirsche sicherlich gefährdend. Außerdem wurden in NRW bislang viel zu wenig Verbissgutachten für die Reviere angefertigt. In Zukunft sollten revierweise Verbissgutachten auf Antrag der Waldbesitzer leicht möglich sein und rasch umgesetzt werden.
Von größter forstlicher Bedeutung ist der Winterverbiss, der in den Monaten Januar bis März (bzw. bis zum Vegetationsbeginn, Zeitpunkt: erstes Mal Rasen mähen) stattfindet. Das Verhältnis von Rehwilddichte und Nahrungsangebot in dieser Zeit ist entscheidend für den Umfang des jährlichen Wildschadens bzw. für die junge Vegetation, die den Winter unbeschadet überlebt. Wenn ab Januar hohe Rehwilddichten auf ein rasch abnehmendes Nahrungsangebot treffen und auch die wichtigste Äsungspflanze der Rehe im Winter, die Brombeere, kaum noch frisches Grün liefert, müssen die Rehe auf ungeliebte Grünäsung, wie Ilex, Ginster und Binsen „umsteigen“ sowie Rohfaser fressen (holzige Triebe junger Bäumchen mit Knospe; vgl. König et al., 2016). Wie Oehlke (2021) im Rahmen einer studentischen Arbeit zeigen konnte, wurden im Forschungsrevier im Winter (2020/) 2021 neben der Brombeere auch die „Notäsungspflanzen“ Ginster, Ilex und Binse verbissen. Der z. T. starke Verbiss von Ginster und Ilex im „Nadelöhr“ Spätwinter zeigt – in Kombination mit der nach wie vor existenten Entmischung der Eiche – dass die Rehwilddichte im Revier nach wie vor so hoch ist, dass der Nahrungsbedarf der Rehe über ungeliebte Notäsungspflanzen gedeckt werden muss. Zu Beginn des Projektes (2017) wurden im Winter zudem 36 % der Buchen von den Rehen verbissen. Je höher die Rehdichte im Januar bis März ist und je weniger eiweißreiche Grünäsung zur Verfügung steht, desto größer wird der Verbissdruck auch auf die holzigen Sträucher und Bäume.
Die Entmischung, die durch das selektive Fressverhalten der Rehe entsteht betrifft nicht nur Baumarten. Die im Revier zu Projektbeginn nachgewiesene Entmischung der Baumarten Eiche, Esche, Bergahorn, Eberesche, Salweide, Aspe, Vogelkirsche und Hainbuche steht dabei nur stellvertretend auch für krautige Arten und Sträucher. Auch deren Entmischung bedeutet den Verlust von ökologischen Nischen. Zum Beispiel ist der Braune Eichenzipfelfalter (Satyrium ilicis) an Eichen bis 2 m Höhe gebunden und daher „stark gefährdet“, weil Eichengebüsche immer seltener werden.
Über Entmischungseffekte bei krautigen Arten, z. B. auf den beliebten Hasenlattich oder Orchideen wie Knabenkraut- oder Stendelwurz-Arten gibt es bislang kaum wissenschaftlichen Erkenntnisse. Dabei dürften Entmischungseffekte gerade auf seltene oder gar gefährdete Arten der Krautschicht gravierende ökologische Folgen nach sich ziehen. Vergegenwärtigt man sich das Ausmaß der Entmischung bei den Baumarten und überträgt dieses auf seltene krautige Arten, liegt die Vermutung nahe, dass die Auswirkungen auf diese eiweißreichen Pflanzenarten ebenfalls immens sein müssen. Für gefährdete Arten, wie z. B. die in Buchenwäldern vorkommende Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens, RL 3 (LANUV 2010)), kann die Entmischung zur lokalen Auslöschung und somit zur weiteren Verschlechterung des Erhaltungszustands führen. Das Vorkommen - oder eben das Fehlen - von Hasenlattich und Wald-Weidenröschen kann als Indikator für die Wilddichte des Revieres herangezogen werden (Prien&Müller 2010).
Das Fehlen einer Pflanzenart in einem Ökosystem hat weit reichende Auswirkungen. Gerade die Biomasse der krautigen Arten ist wichtig für die Bodenbildung, insbesondere auf den Fichten- Kalamitätsflächen mit Nadelstreuauflagen. Auch für die Biozönosen im Wald wirkt sich das Fehlen einzelner Arten gravierend aus. Zum Beispiel konnte im Forschungsrevier gezeigt werden, dass das Wald-Weidenröschen als typische Pionierart (mit wichtigen Funktionen) auf den Kalamitätsflächen komplett von den Rehen selektiert wurde. Außerhalb der Gatter kam auf den Schlagfluren kein Individuum dieser Art zu Blüte. Damit fällt diese wichtige Art als Wirtspflanze für Waldinsekten aus. Besonders für einige Schwärmerarten sind Weidenröschen wichtige, teils essentielle Raupenfraßpflanzen (Schmidt 2014). Für etliche Wildbienen und Erdhummeln ist es (wäre es) eine wichtige Weidepflanze (Smagy 2021). Der Ausfall einzelner Arten zieht eine „Kaskade des Artensterbens“ nach sich (Rooney 2001, Scherber et al., 2010). Denn an jede Pflanzenart sind etliche spezialisierte Tierarten gebunden, die beim Fehlen der Pflanzenart in dem Biotop nicht vorkommen können – selbst wenn alle anderen Requisiten vorhanden sind. Welche Auswirkungen der Verbiss auf weitere krautige Pflanzen hat, wurde im Forschungsprojekt nicht untersucht. Am Beispiel des Weidenröschens zeigt sich aber, dass durch die hohe Verbissintensität wahrscheinlich auch viele andere typische krautige Waldarten (z. B. Hasenlattich) an der Ausbreitung bzw. einem dauerhaften Festsetzen gehindert werden. Starker Verbiss und die daraus resultierende Entmischung der Waldkrautschicht haben einen deutlichen negativen Einfluss auf die Biodiversität der Wälder. Zwar gibt es auch den positiven Effekt, dass die Zahl krautiger Arten steigt (Boulanger et al., 2018). Dies sind aber meist euryöke „Allerweltsarten“ aus dem Offenland. Das heißt, wenn eine Waldart lokal erlischt, verschwinden damit viele charakteristische Wald-Tierarten. Wenn stattdessen mehrere euryöke Arten einwandern, erhöht sich allenfalls die Vielfalt an Störungszeigern bzw. an Arten, die auch in angrenzenden Offenlandstandorten vorkommen.
In der Vergangenheit wurden von der Wildbiologie häufig die ökologischen Funktionen des Schalenwildes betont, wie die Zoochorie oder die Schaffung von Sonderhabitaten durch Tritt und Verbiss (z. B. Kinser et al., 2017). Die Hauptfunktionen der Rehe und Hirsche, das Zersetzen von Biomasse und das „Beute sein“ für Prädatoren, sollte an der Stelle auch genannt werden. Negative ökologische Auswirkungen zu hoher Schalenwildbestände auf die Ökosysteme, wie sie durch Entmischung entstehen, sind bislang noch nicht ausreichend erforscht. Dies gilt auch für die so wichtige Humusbildung in Waldböden, die gerade jetzt auf den Kalamitätsflächen mit Nadelstreuauflagen ein entscheidender Faktor der Wiederbewaldung ist. Überhöhte Wildbestände, die die krautige Biomasse als organische Substanz auf den Flächen erheblich limitieren, gefährden eine ausreichende Humusbildung (vgl. Ewald et al., 2022).
Die Limitierung oder gar völlige Entmischung der Pioniergehölze Eberesche, Salweide und Aspe auf den Kahlflächen der Hainsimsen-Buchenwald-Standorte hat darüber hinaus negative Effekte auf die Wiederbewaldung. Wichtige Funktion dieser Vorwaldarten ist neben der Bodenverbesserung (Stark et al., 2011, Otto 1994) der Schutz des Bodens und der nachfolgenden Vegetation vor Spätfrösten, Erosion und direkter Sonneneinstrahlung bzw. Hitze. Erst im Schutze der Vorwaldarten können sich die „Hauptbaumarten“ etablieren. Je weniger Vorwaldbäumchen auf der Fläche sind, desto stärker erhitzen sich die Böden und trocknen aus.
Limitierender Verbiss wirkt sich nicht nur auf die Bilanz des Waldbesitzers und die Bodenbildung aus. Auch hinsichtlich der angestrebten Resilienz (Fähigkeit, sich zu erholen), die „klimastabile“ Wälder künftig aufweisen sollen, ist ein möglichst geringer Verbisseinfluss angezeigt. Denn es müssen nicht nur möglichst sämtliche Arten der heutigen potentiell natürlichen Vegetation wachsen können (das sind alle Arten, die auf die Fläche/ an diesem Standort ohne direkten Einfluss des Menschen wachsen würden). Die Arten müssen auch mit vielen Individuen in der Verjüngung vertreten sein. Denn je artenreicher die Verjüngung und je individuenreicher die Verjüngung, desto besser. Denn je mehr Individuen einer Art am Standort wachsen, desto größer sind die Möglichkeiten zur Anpassung an klimatische Veränderungen durch epigenetische Prozesse. Diese Effekte können dazu beitragen, dass die Samen aus Jahren mit starken Hitzeperioden in Folge deutlich hitzetolerantere Pflanzen hervorbringen (Hosius et al., 2019). Je mehr Naturverjüngung sich etablieren kann, desto größer ist also die Chance, dass resistente Pflanzen nachwachsen. Zum Glück weisen „heimische Waldgesellschaften noch große Potentiale in ihrem genetischen System auf, um auch im Klimawandel anpassungs- und überlebensfähig zu sein“ (Hussendörfer 2021).
Die Entmischung der letzten Jahrzehnte hatte allerdings in NRW zur Folge, dass sich die heimischen Waldgesellschaften kaum noch natürlich verjüngen können (Bieker&Heute 2021; Striepen 2013) und aufgrund der andauernden Entmischung immer weiter schrumpfen (auf mittlerweile < 8 % der Waldfläche NRW’s).
Die finanziellen Auswirkungen von Verbissschäden und Entmischung sind schwer greifbar. Das liegt insbesondere daran, dass die Entmischungseffekte kaum messbar sind. Der Keimling, der gefressen wurde, ist nicht mehr sichtbar. Ebenso wenig das Phänomen, dass alle Keimlinge und Zweijährige einer Art vollständig gefressen wurden und somit eine komplette Pflanzenart im Artenspektrum fehlt. Man stelle sich vor, in der Landwirtschaft wäre es nicht möglich, einzelne Arten zu kultivieren, weil alle Sämlinge vom Wild aufgefressen werden, z. B. vom Mais.
Dennoch können die finanziellen Wildschäden zumindest abgeschätzt bzw. das Einsparpotential ermittelt werden, das durch angepasste Wildbestände entsteht. Von Trotha hat bereits 2010 - nach Analyse von 81 Forstbetrieben (119.000 ha) – berechnet, dass jedes erlegte Reh in den ersten fünf Jahren des Waldumbaus zu einer betriebswirtschaftlichen Ersparnis von 1.500 € führte. Der Saldo aus Verlusten aus der Jagd (entgangene Jagdpacht) und Ersparnis beim Waldumbau betrug jährlich 155 € pro Hektar (von Trotha 2010). Im Forschungsrevier sind pro 100 ha etwa 13 Rehe mehr erlegt worden als vor Beginn des Projektes in der Jagdpacht. Das entspricht, nach Trothas Werten, einer Entlastung um 19.500 pro 100 ha bzw. 195 € pro Hektar.
Auch ein weiteres Rechenbeispiel verdeutlicht den finanziellen Vorteil von zielorientierter Jagd gegenüber der Hegejagd mit Höchstgebot-Verpachtung. Bei dem Beispiel gehen wir davon aus, dass bei Beibehaltung der herkömmlichen Jagd aufgrund der signifikanten Entmischung keine artenreiche Wiederbewaldung ohne Schutzmaßnahmen möglich gewesen wäre. So wie es die Situation vor der Projektlaufzeit war und wie es die aktuelle Situation in den meisten Regionen NRW‘s ist (u. a. Heute 2021). Das waldbauliche Ziel des artenreichen, „klimastabilen“ Mischwaldes wäre nur hinter wilddichten Zäunen realisierbar gewesen. Auch in diesem Fall können wir nur das Einsparpotential berechnen, das mit der Umstellung der Jagdstrategie entstanden ist. Die Gatterung der ca. 20 Hektar Kalamitätsflächen, die 2018 bis 2021 im Revier entstanden sind, würde den Eigentümer rund 76.000 € (netto) für den Bau, 8.000 € für zehn Jahre Kontrolle und Wartung sowie mindestens 20.000 € für den Abbau und die Entsorgung kosten. Zuzüglich der Kosten für konventionelle, flächendeckende Aufforstung mit Großpflanzen von ca. 180.000 € würde die Wiederbewaldung der Flächen 356.000 € kosten.
Bei einer Jagd - wie im Projekt praktiziert - und entsprechend angepasstem Rehbestand wird ein naturnaher Waldbau mit Nutzung des riesigen natürlichen Verjüngungspotentials ohne Zaun überhaupt erst möglich. Mit Nutzung dieses Potentials könnte ein partielles Bepflanzen von max. 50 % der Flächen ausreichend sein. Die Gesamtkosten für die Wiederbewaldung beliefen sich in diesem Fall auf 40.000 €. Das entspricht 2.000 € pro Hektar anstatt 17.800 € pro Hektar. Eine artenreiche und standortgerechte Wiederbewaldung (gemäß der aktuellen Waldbaukonzepte) kostet den Eigentümer bei hoher Wilddichte und unzureichender Bejagung also etwa das Neunfache.
Leider wird der aktuelle Zustand - die Wilddichten sowie die arten- und strukturarmen Kraut- und Strauchschichten unserer „Wälder“ - von den meisten Beteiligten als Normalität und Maßstab aufgefasst. (Das Phänomen wird in der Umweltwissenschaft als „shifting baseline“ bezeichnet; vgl. Blank et al., 2021). Das Ausmaß der gesamten Waldschäden ist dagegen nur sehr wenigen bewusst. „Unter dem Verbissdruck eines widernatürlich überhöhten, unterbejagten Bestands an Rehen und Rotwild ist die Waldbodenvegetation unvorstellbar verarmt…“ (Sperber&Panek 2021). Stattdessen wird das Ausmaß selbst von manchen Förstern, aufgrund der sehr weit verschobenen „shifting baseline“, nicht annähernd realistisch erkannt. Viele Forstabsolventen haben noch nie in einem Naturwald gestanden. Und viele haben auch noch keinen artenreichen, natürlichen und sich natürlich verjüngenden Wald gesehen. Der gewohnte Anblick der seit Jahrzehnten entmischten, arten- und individuenarmen Kraut- und Strauchschicht des Waldes wird als „normal“ aufgefasst und zum Maßstab genommen, obwohl die Problematik bereits 1935 von dem amerikanischen Forstmann und Ökologen Aldo Leopold als „the german problem“ identifiziert worden war (ebd.). Und die meisten Jäger empfinden die sich über Jahrzehnte aufgebauten, teils extrem hohen Schalenwildbestände als „normal“, die „shifting baseline“ ist hier auf Höhen von 40 Stück Schalenwild und mehr pro 100 Hektar verschoben worden.
Der Maßstab in Zeiten des Artensterbens und Klimawandels muss aber derjenige sein, den wir in den sehr wenigen „best-practice“- Revieren sehen können: ein strukturierter Dauerwald, der sich selbst mit allen Arten der (heutigen) potentiell natürlichen Vegetation verjüngt.
In den meisten Revieren NRW‘s findet sich kein naturnaher Dauerwald, der sich selbst verjüngen würde. Zudem sind seit dem ersten Trockenjahr 2018 etwa 115.000 ha Kalamitätsflächen (LWuH 2021) entstanden, die nun wiederbewaldet werden sollen. Zum Vergleich: Der Orkan Kyrill hat 2017 ca. 30.500 Hektar größere Windwurfflächen hinterlassen (LWuH 2022).
Dabei zielen sämtliche aktuellen Waldbaustrategien und Wiederbewaldungskonzepte des Landes (z.B. MULNV 2018, MULNV 2021) auf eine möglichst artenreiche Verjüngung der Wälder ab und betonen die Bedeutung der Jagd für eine erfolgreiche Wiederbewaldung. Denn: jede einzelne Kahlfläche würde sich von selbst wieder bewalden (natürliche Sukzession; Ellenberg&Leuschner 2010; Heute 2017), sofern die Reh- und Hirschbestände gering wären.
Da leider das Gegenteil der Fall ist, werden künftig nicht nur forstliche Maßnahmen wie Flächenräumung, Bodenvorbereitungen und Anpflanzungen vom Land gefördert, sondern auch Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss (MULNV-NRW: „Förderrichtlinie Extremwetterfolgen“). Und zwar unabhängig davon, ob der Rehwildbestand in dem jeweiligen Revier angepasst ist oder (viel) zu hoch. Und da die Rehbestände in den meisten Revieren deutlich zu hoch sind und die Kalamitätsflächen überwiegend nicht durch Wildzäune geschützt werden, wird sich dort keine diverse Verjüngung einstellen können. Und die aufwändigen und kostspieligen Anpflanzungen, insbesondere der seltenen Mischbaumarten und der Eichen, werden zu einem großen Teil durch Verbiss und Fegen zerstört werden, wie es auch schon nach Kyrill passiert ist (vgl. Heute 2017). Die Konsequenz wird sein, dass die Flächen sich nicht zu artenreichen, „klimastabilen“ Wäldern entwickeln werden, wie es Eigentümer und Gesellschaft erwarten. Nur in den Revieren, in denen bereits waldorientiert gejagt wird oder die Umstellung jetzt unverzüglich vollzogen wird, werden sich artenreiche Wälder begründen können. In diesen Revieren (grüne Ampel) wäre auch eine staatliche Förderung von Hochsitzen, Schussschneisen, Hundeschutzwesten etc. gerechtfertigt und hilfreich.
Netzwerk Vorbildliche Rehwildreviere
In NRW gibt es kaum Gemeinschaftliche Jagdbezirke, in denen artenreiche Waldverjüngungen zu finden sind, weil Waldwildschäden bei den Jagdpächtern i. d. R. keine Rolle spielen. Die Schäden werden nicht erkannt oder ignoriert und ein Schadenersatz muss meist nicht geleistet werden – im Gegensatz zu den leicht erkenn- und erfassbaren Schwarzwildschäden in Mais oder Grünland.
In allen Revieren des Netzwerks, also Revieren mit „funktionierender“ Walderneuerung, wurde die traditionelle Bejagung beendet und die Jagdstrategie verändert. In fast allen Revieren wurden hierzu Jagdpachten aufgelöst bzw. Pachten nicht weiter verlängert. Zwar gibt es wenige Positivbeispiele von Pachtrevieren (vgl. Boschen 2021). Die Pächter dieser Reviere sind aber durch die Eigentümer i. d. R. vertraglich verpflichtet, Mindestabschüsse zu tätigen, den körperlichen Nachweis zu erbringen, gemeinsame Revierbegänge zu tätigen und die Bejagung durch den Eigentümer zu akzeptieren, wenn absehbar ist, dass der Pächter die Zielvorgaben deutlich verfehlt. Aus dem Netzwerk ist kein Revier bekannt, das bei Beibehaltung der Rahmenbedingungen Hegejagd/ Jagdpacht erfolgreich gewesen wäre.
Die Erfahrungen der Netzwerkreviere zeigen sehr deutlich, dass ohne eine Änderung der Jagdstrategie keine Waldverjüngung möglich ist, die den Anforderungen an den zwingend notwenigen „Waldumbau“ genügt. Die meisten Reviere des Netzwerkes wurden daher in die Eigenbejagung übernommen. Dabei stellte sich als eines der größten Probleme bei der Umstellung die Schwierigkeit heraus, rasch genügend geeignete Jäger zu finden, die den hohen Anforderungen gerecht werden konnten. Am besten konnten Jäger integriert werden, die in einem Jagdteam mit professioneller Jagdleitung angeleitet wurden. Als eigenverantwortliche Begehungsscheininhaber in einem Pirschbezirk mit Zielvorgaben taten sich viele Jäger, die zuvor noch keine Erfahrungen mit der konsequenten Waldjagd gesammelt hatten, dagegen schwer.
Viele Waldeigentümer können nicht ihre ganze Fläche selbst, also per Regiejagd, bejagen. Es fehlt an Personal und die Eigenbejagung ist sehr kostspielig. Da die Gefahr besteht, sich bei einer Jagdverpachtung langfristig an einen nicht geeigneten Pächter zu binden, rückt seit einigen Jahren immer mehr das Modell „Pirschbezirk“ in den Mittelpunkt vieler Forstbetriebe. Die Rahmenbedingungen für Pirschbezirke können sehr unterschiedlich sein (z. B. jagdliche Einrichtungen/ Kühlzellen werden vom Betrieb gestellt oder nicht), jedoch haben Pirschbezirke für die Eigenjagdbesitzer große Vorteile gegenüber der teuren Regiejagd und der riskanten Verpachtung:
- Es sind kurze, auch einjährige Vertragslaufzeiten möglich
- Der Eigentümer kann - bei dringendem Bedarf - eingreifen und selbst auf der Fläche (mit-)jagen
- Der Eigentümer hat im Gegensatz zur Regiejagd wenig Arbeit mit den Pirschbezirken (vgl. Meier 2018), da die Begehungsscheininhaber „pächterähnlich“ und weitgehend selbstbestimmt jagen
Optimal ist es, wenn Begehungsscheininhaber eines Pirschbezirkes eigenständig Leistungen erbringen und den Jagdbetrieb in ihrem Pirschbezirk zuverlässig leiten und „Strecken liefern“. Bislang haben viele Eigenjagdbesitzer noch Probleme, geeignete Begehungsscheininhaber zu finden. Manche Betriebsleiter verkleinern die Pirschbezirke daher auf z. B. 30 Hektar (Salm-Boscor), so dass mehr Jäger auf der Fläche jagen und die Rehwildstrecke so gesteigert wird.
Die Netzwerkreviere sind auch diejenigen Reviere in NRW, die besonders erfolgreich waren in der Wiederbewaldung der Kyrillflächen nach 2007. Hierbei wurde deutlich, wie wichtig die Bestückung aller Kahlflächen mit hohen Kombisitzen war. Auf großen Flächen wurden breite Bejagungsschneisen dauerhaft freigehalten, so dass hier auch noch geschossen werden konnte, als die Bestände ins Dickungsstadium gewachsen waren. In den letzten Jahren wurden an Kalamitätsflächen zudem weitere Jagdarten sehr erfolgreich praktiziert. So ist die Pirsch mit Wärmebildkamera besonders in reliefiertem Gelände sehr effektiv. Auch die Bejagung vom Klettersitz - von Überhältern oder Bäumen am Parzellenrand aus - kann sehr erfolgreich sein. In manchen Revieren des Netzwerkes werden im Rahmen der Einzeljagd bis zu 65 % des Rehwildes bei der Pirsch und/ oder vom Klettersitz erlegt.
Im Austausch zwischen den Netzwerkmitgliedern wurden immer wieder ähnliche Erfahrungen ausgetauscht. So erfuhren viele von ihnen abweisende und mitunter sogar aggressive Ablehnung gegenüber der konsequenten Rehjagd aus Jagdpächterkreisen in ihrem Umfeld. Einige Jagdleiter wurden diffamiert und sogar denunziert. Eine Ablehnung der waldorientierten Jagd lässt sich allerdings nicht mit wissenschaftlichen Fakten begründen. Im Gegenteil: Intensiv bejagtem Rehwild - so paradox es sich anhört - geht es besser! Sie leiden weniger an Parasiten, weisen eine bessere Konstitution auf, es gibt weniger Verkehrsunfallleid, weniger Konkurrenz und dadurch mehr Ruhe und bessere Nahrung (vgl. Lang&Jakob 2014, Hespeler 2016, Straubinger 2016, Heute 2016, Boschen 2021).
Häufig wird aus angrenzenden Pachtrevieren ein sogenannter „Vakuum- Effekt“ beklagt, der durch die konsequente Rehjagd verursacht werde. Der Begriff suggeriert, dass Rehe der Nachbarreviere durch die „leer geschossenen“ Areale angesogen würden. Aufgrund der Abwanderung der Rehe würde die Rehdichte in den umliegenden Revieren dann abnehmen.
Selbstverständlich gibt es keinen „Vakuum- Effekt“. Erstens wird kein Vakuum erzeugt, wenn ein Revier mehr schießt als das Nachbarrevier. Zweitens gibt es keinen Sog-Effekt. Kein Reh aus dem Nachbarrevier wittert, dass hinter der Reviergrenze eine Homerange eines Rehes temporär frei geworden ist. Auch läuft kein Reh über die Reviergrenze, weil es auf der anderen Seite so oft knallt.
Es gibt natürlich den Effekt, dass das intensiv jagende Revier Rehe aus dem Nachbarrevier mit schießt. Das sind aber – mit Ausnahme von Böcken in der Blattzeit – fast ausschließlich Schmalrehe und Jährlinge, die im Frühjahr aus den extensiv bejagten Revieren abwandern, weil die Dichte dort sehr hoch ist und nicht, weil die Dichte im Nachbarrevier geringer ist. Der Effekt beschreibt genau das Gegenteil dessen, was beabsichtigt ist: Nicht das intensiv jagende Revier schießt zu viel, sondern das extensiv jagende zu wenig Rehe.
Treffend ist hierzu die Beschreibung von WIKIPEDIA zur Erforschung des Vakuums bzw. des Vakkum-Effektes: „Der beobachtete Effekt ist allerdings keine direkte Eigenschaft des Vakuums, sondern vielmehr durch den Druck der umgebenden Luft bedingt.“ Der Begriff des angeblichen „Vakuum- Effektes“ ist eines der vielen Dogmen, die sich über Jahrzehnte der Hegejagd in Jägerkreisen festgesetzt haben.
In den ersten ein, zwei Jahren nach Umstellung der Jagdstrategie gestaltete sich die Bejagung der Rehe recht einfach, da die Jäger auf sehr viele Rehe treffen, die wiederum wenig Erfahrung/ wenig Angst haben. So ist es möglich, dass in einzelnen Revieren im ersten Jahr mehr als 50 Rehe pro 100 Hektar erlegt werden können. In vielen Revieren, in denen anschließend eine deutliche Verbesserung der Waldverjüngung einsetzte, wurden zunächst etwa 20 Rehe pro 100 Hektar erlegt, z. T. auch deutlich mehr. Bei einigen wenigen Revieren reichten auch geringere Abschusszahlen, um eine Verbesserung herbei zu führen. Wichtig für den andauernden Erfolg war es, die jagdliche Intensität im Laufe der Jahre hoch zu halten oder auch weiter zu steigern. Erst wenn die Streckenzahlen bei mindestens gleichbleibender, hoher Intensität über die Jahre zurückgehen, kann man auf eine Reduktion des Grundbestandes schließen.
Im Laufe der Jahre wird die Bejagung erschwert. Zunächst aufgrund des veränderten Verhaltens des nun achtsameren Rehwildes, später durch die immer dichter werdende Kraut- und Strauchschicht im Wald. Häufig ist dann von Jägern zu hören, dass „keine Rehe mehr da“ seien. Die Erfahrungen aus den Netzwerkrevieren haben aber gezeigt, dass sehr wohl anhaltend hohe Strecken erzielt werden können. Entscheidend hierbei ist die Einstellung und Qualität des Jägers im Revier. Oft steigern die Jäger ihre Effektivität noch mit den Jahren, in denen sie das Revier und das Wildverhalten besser kennen lernen. Eingespielte, örtliche Jagdteams mit den entsprechenden Erfahrungen und Erkenntnissen können nicht ohne Qualitätsverlust ersetzt werden.
In der Vergangenheit wurden, auch im Umfeld der Netzwerkreviere, immer wieder Konzepte zur Lösung der Wald- Wildschadenproblematik vorgeschlagen, die vor allem auf klassischen Hegemaßnahmen beruhten. So sollten Ruhezonen, die Anlage von Wildäsungsflächen, Besucherlenkungen etc. zu einer Entschärfung der Wildschadensituation führen. Abgesehen davon, dass es kaum einem Jagdpächter, geschweige denn einem Pirschbezirksinhaber möglich ist, Ruhezonen im Revier einzurichten oder Besucher zu lenken: Bei Rehwilddichten, die ein Mehrfaches höher sind als für das Ökosystem tragbar, bewirken Ruhezonen überhaupt nichts. Das Verhältnis zwischen Rehwildhunger und Winternahrung stimmt nicht und die fehlende Nahrung kann auch nicht durch mehr Ruhe kompensiert werden.
Besonders in Rotwildgebieten wurden in den letzten Jahren so genannte „Lebensraumgutachten“ erarbeitet. Doch wissenschaftliche Nachweise von Erfolgen gibt es hierzu kaum, oder sie beziehen sich nur auf einen partiellen oder/ und temporären Rückgang der Schälprozente weniger Arten. Bislang gibt es kein „Lebensraumgutachten“, das bewirkt hätte, aus einem entmischten Wald einen artenreichen Wald mit sämtlichen Arten des Standortes zu entwickeln. Im Gegenteil: Im Biosphärenreservat Pfälzerwald wurde 2013 in der 2.400 ha großen Kernzone „Quellgebiet der Wieslauter“ eine Jagdruhe ausgewiesen. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz konnte in seinem Lebensraummonitoring keine Effekte der Jagdruhe auf Leittriebverbiss und Neuschäle feststellen. Und die Eichen wurden in dem Gebiet nach wie vor komplett selektiert, so dass weiterhin keine Eichenverjüngung stattfinden konnte. Und das bei relativ geringen Dichten von drei bis vier Hirschen pro 100 ha (HOHMANN ET AL., 2018).
Im Märkischen Kreis ist 2014 von einer Forstbetriebsgemeinschaft Hilfe suchend ein Projekt angestoßen worden, um die starken Verbissschäden in dem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk zu verringern. Das Projekt, mit vielen „runden Tischen“, an denen verschiedenste „Stakeholder“ viele Stunden debattierten, mündete in ein Lebensraumgutachten, das zur Verbesserung der Wald-Wild-Situation führen sollte. Nach vielen Jahren der Exkursionen, Arbeitsgruppentreffen, Beratungsgesprächen und Absichtserklärungen der Jagdpächter stellte sich (erst) nach einem mehrjährigem Zeitraum heraus, dass das Projekt bzw. das Lebensraumgutachten vollkommen gescheitert waren. Die Verbissschäden waren 2021 mit einem Leittriebverbiss bei Laubholz von über 70 % noch genauso hoch wie 2014 und die Waldverjüngung nach wie vor signifikant entmischt (Heute 2021).